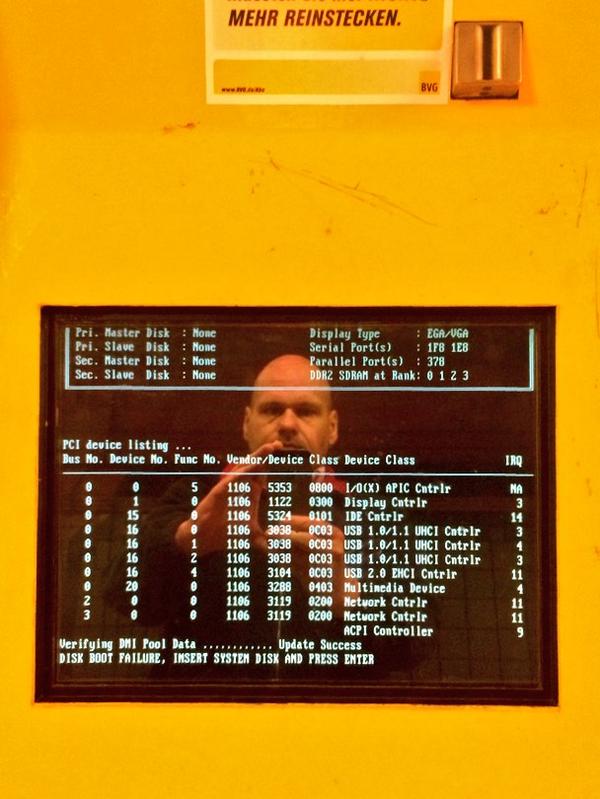»Share Economy« ist ein Wort, das in meiner Kladde steht. Damit möchte ich mich demnächst etwas mehr beschäftigen. Carsharing gehört sicher dazu, wobei die Idee, sich mit mehreren Menschen – die man persönlich kennt oder auch nicht – ein Auto zu teilen, längst nicht neu ist. Sie ist weit älter als der Gedanke der Share Economy. Immer mal wieder habe ich über Carsharing nachgedacht und immer wieder hatten die realen Möglichkeiten zumindest gefühlte Nachteile. Meist brauche ich ein Auto für mehrere Tage oder mindestens für einen ganzen Tag. Für Ausflüge, Urlaub, etc. Das ist gerade so eine Verwendungsart, wo Carsharing und Mietautos oft ziemlich teuer werden. Aus dem Grund besitze ich seit 18 Jahren mein immerhin jetzt 25 Jahre altes Automobil, eine Limousine mit dem Stern.
Vom Blogger Netzwerk blogabout.it bekam ich vor kurzem die Anfrage, ob ich nicht Multicity-Carsharing, das Carsharing von Citroen, das nur Elektroautos verwendet und das es nur in Berlin gibt, testen möchte. Obwohl ich sonst kein Autofreak bin, kommt das Angebot gerade passend. Miz Kitty kann dann nämlich mein Auto nehmen, wenn sie in den Garten nach Pankow fährt und ich bin nicht auf U-Bahn oder Taxi angewiesen, wenn es jetzt kälter wird und das Fahrrad unbequem wird. Mit dem Multicity-Car kann ich dann schnell nach Charlottenburg fahren, ohne dass wir uns um das Auto »kloppen« müssen. Multicity als Mobilitätskomfort für Zwei-Personen-Haushalte, die ein Auto haben, aber wo beide manchmal gleichzeitig ein Auto brauchen. So die Idee, Multicity einmal näher anzuschauen. Dafür ist Multicity sicher gut geeignet.
Elektroautos
Multicity-Carsharing gibt es bisher nur in Berlin und alle Autos sind reine Elektroautos vom Typ Citroen C-Zero, den man auch für 29.393 € kaufen kann, 100% elektrisch, wie Citroen auf der Internetseite zu diesem Auto schreibt.
Mit Elektroautos bin das erste Mal im Studium in Berührung gekommen. Damals wie heute war der geringe Aktionsradius das Thema schlechthin. Allerdings gab es schon damals Konzepte, diese geräuschlose und zweifelsfrei umweltfreundlichere Variante des Individualverkehrs massentauglich zu machen. Soweit ich mich erinnere, sollte mit austauschbaren Akku-Paketen erfolgen, die alle 50 km an einer Akkustation, sprich Tankstelle, ausgetauscht werden konnten, so ähnlich, wie früher die Pferde der Postkutschen gewechselt wurden. Nun, heute setzt man auf »Strom-Tanksäulen«, warum auch immer? Vor drei Jahren wurde direkt vor dem Haus, in dem wir wohnen, so eine eine Strom-Tanksäule errichtet. Mmh, dachte ich zuerst, wieder zwei Parkplätze weg. Vor allem, weil dort in der ersten Zeit nie ein Elektroauto »betankt« wurde. Das hat sich inzwischen geändert. Heute stehen hier regelmäßig Elektroautos, oft auch die weiß-violetten Multicity-Cars. Gut für mich, denn ich habe dann direkt eins vorm Haus stehen.
Alle Fotos sind übrigens (bis auf die roten Flinkster-Cars) direkt bei mir vorm Haus fotografiert. Die Flinkster Cars gehören in etwa zu Multicity dazu, denn Multicity-Kunden können auch Flinkster Autos mieten und umgekehrt. Die beiden Carsharing-Anbieter kooperieren miteinander. Auch das Multicity-Büro ist gleichzeitig das Flinkster-Büro an der Schönhauser Allee 173.

Free Floating
Während Flinkster, der Carsharing-Anbieter der Deutschen Bahn – ebenso wie StattAuto schon vor ewigen Zeiten – das Modell des stationären Carsharing verfolgt, bei dem die Fahrzeuge an festen, bekannten Standorten geparkt sind, werden die Multicity-Autos einfach auf Parkplätzen an der Straße abgestellt. Man kann sie am Fahrtziel einfach auf dem nächstbesten öffentlichen Parkplatz abstellen. Ein Parkschein ist für Multicity-Autos nicht erforderlich.
Car2go und DriveNow, die Alternativen zu Multicity, die es auch in anderen Städten gibt, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Dieses bezeichnet man auch als »free-floating-carsharing« innerhalb eines Geschäftsgebietes. Da es bekanntlich viele Straßen in Berlin gibt, funktioniert das Modell erst richtig gut mit Smartphones und Internet. Über die Multicity-App, die es selbstverständlich für iOS und Android gibt, ist ein Auto schnell gefunden. Dessen Ladestand wird angezeigt und man kann es für 15 Minuten reservieren, damit es einem keiner vor der Nase wegschnappen kann, während man gerade auf dem Weg zu zu diesem Auto ist. Mit einer Code-Karte, die wie ein Schlüssel funktioniert, kann man das Auto dann öffnen und losfahren.
Anmeldung und Registrierung
Die Anmeldung bei Multicity ist einfach. Ich habe sie am Freitag Nachmittag schnell zwischen zwei Terminen erledigt. Daten im Internet auf der Multicity-Seite eingeben, dazu meinen Gutscheicode für die kostenlose Registrierung und die Freiminuten, ausdrucken, unterschreiben und ab zu einem Multicity-Partner. Führerschein und Ausweis werden dort geprüft und man bekommt die Multicity-Karte, mit der sich die Autos öffnen lassen. Ich war im Multicity-Flinkster-Büro an der Schönhauser Allee und der Vorgang war in ein paar Minuten erledigt. Zusätzlich bekam ich noch einmal 30 Freiminuten. Regulär kostet die Registrierung 9,90 Euro inklusive 30 Minuten Guthaben. Es rechnet sich also auch für Berlin-Besucher. Für 9,90 Euro registrieren und mit dem Multicity zum Bahnhof gondeln, das mag wohl halb so teuer sein wie ein Taxi, womit die Karte amortisiert ist.
Praxistest
Vorgestern morgen haben wir ein Multicity-Elektroauto das erste Mal getestet. Am Sonntagmorgen waren wir zum Frühstück am Helmholtzplatz verabredet. Ein Auto war schnell per App gefunden. Es stand nicht an der Stromsäule vor unserer Haustür, sondern ca. 200 Meter weiter, allerdings miserabel eingeparkt, wofür der Vor-Benutzer sicher gar nichts kann, sondern die vor und hinter dem Auto parkenden, wie es oft so ist, wenn längs der Straße alle mit wenig Abstand zum Vordermann hintereinander stehen. Etwa so, wie in meinem Foto, wobei das Auto dort nach hinten Platz hat.
Da ich in unserem Haushalt weder einen LKW-Führerschein habe, noch das »native Ein- und Ausparkwunder« bin, – alles das trifft jedoch auf Miz Kitty zu – hatte ich leichte Probleme, das Elektromobil auszuparken. WTF, diese Autos, wo ich weder Anfang noch Ende sehe, auch wenn sie anderthalb Meter kürzer sind als meine alte Sindelfinger Limousine.
Zudem war mir anfangs nicht richtig präsent, dass Elektroautos kein Motorgeräusch haben. Ich habe das Auto ein paar mal gestartet und dachte erst einmal, es funktioniert nicht. Außerdem war ich extrem vorsichtig, da die Automatikautos aus meiner Führerscheinzeit immer mit der Bremse festgehalten werden mussten. Nun, das Auto war wirklich blöd eingeparkt, und bevor aus dem Gekurve ein Slapstick à la Heinz Erhardt wurde, hat Miz Kitty es schnell übernommen, auszuparken (was zwar verboten ist, da es auf mich registriert ist, aber bevor wir nun gar nicht loskommen…).
Nach ein paar hundert Metern hatte ich mich gut daran gewöhnt, dass das der Citroen C-Zero wie ein Autoscooter fährt. Einfach nur Gas geben und bremsen, That’s it. Eher wenig »Kraftfahrzeug«, dafür viel »Autoscooter«, und das ausgesprochen bequem. Positiv überrascht bin ich von dem Mobil, was wahrscheinlich weniger an Citroen liegt, als am scooterartigen Dahingleiten. Freilich, zwei Kameras zum Ein- und Ausparken würden mich richtig glücklich machen. Die Technik gibt es ja schon lange, und für so ein Mietauto, das man nicht jeden Tag fährt, wäre es doch nicht schlecht.
Gute Hotline
Etwas aufregend war der erste Praxistest schon. Als wir am Ziel einen Parkplatz gefunden hatten, war die Multicity-Karte plötzlich weg. Wahrscheinlich ist sie mir beim Aussteigen während der Auspark-Huddelei aus der Tasche gefallen. Also: Hotline anrufen und die Karte sperren lassen. Das klappt am Sonntag morgen tatsächlich gut bei Multicity. Nach einer Abfrage (»Wenn Sie … möchten, wählen Sie die Ziffer …«) meldete sich schnell eine freundliche Dame, die meine Karte sperrte und per Fernsteuerung das Auto aus-checkte und zusperrte. Schön, dass das so unkompliziert funktioniert – und hoffen wir, dass es so bleibt, wenn Multicity mehr Kunden hat. Genauso unproblematisch habe ich heute im Multicity-Büro an der Schönhauser Allee eine neue Karte bekommen.
Darüber, wie man ein Auto findet, öffnet, am Zielort parkt, verschließt und ggf. an der Stromsäule lädt, schreibe ich jetzt nichts. Das alles findet sich auf den Internetseiten von Multicity-Carsharing – und es ist nicht so wesentlich anders als bei anderen Carsharing-Anbietern. Versuch macht klug. Die 9,90 Euro haben sich schnell mit der ersten Fahrt amortisiert.
Für wen?
- Freilich für alle, die gern Auto und Autoscooter fahren, allerdings nicht die röhrende Maschine um sich haben müssen,
- für Menschen, die auch kurze Strecken innerhalb Berlins lieber selbst fahren und weder verranzte Berliner Taxis noch typisches U8-Publikum mögen,
- als Ergänzung für alle Haushalte, die ein Auto haben und manchmal bequemlichkeitshalber zeitgleich ein zweites brauchen,
- für alle, für die »share economy« und Nachhaltigkeit ein Thema ist,
- für Berlin-Besucher, die für 39 Euro einen Tag in der Hauptstadt rumgondeln möchten und dafür nicht Bus, Bahn, oder geführte Touren in Anspruch nehmen möchten.
Für wen eher nicht?
- Für alle, die ein Ziel außerhalb des (doch recht kleinen) Geschäftsgebietes haben,
- für alle, die sich lieber chauffieren lassen und denen Autosuchen, Hinlaufen, das auf vorhandene Schäden betrachten, Stadtverkehr, und Parkplatzsuche am Ziel zu mühselig ist,
- für große Jungs und gestandene Männer, die nicht im violetten »Mädchen-Auto« herumfahren möchten.
Im folgenden noch ein paar Besonderheiten zum Multicity-Carsharing:
Tarif und Preis
Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Der Mietpreis mit 28 Cent pro Minute ist sicher ganz akzeptabel, für manche kurze Strecken jedoch nicht ohne, vor allem, wen man am Ziel noch einen Parkplatz suchen muss. Letztens bin ich in der Feierabendzeit vom meiner Wohnung am Zionskirchplatz nach Tempelhof gefahren und hatte – in Berlin die Ausnahme – einen guten Taxi-Chauffeur. Wir waren, mehr oder weniger im Stau, ca. 40 Minuten unterwegs und ich habe ungefähr 19 Euro bezahlt. Mit Multicity wäre ich wahrscheinlich genauso lange unterwegs gewesen und hätte 11,60 bezahlt, plus ein paar Minuten für Parkplatzsuche in der engen Tempelhofer Straße. Vermutlich sind das 5 bis 6 Euro Ersparnis, nicht so sehr viel. Die minutengenaue Abrechnung hat leider einen Nachteil, der nichts mit Multicity zu tun hat, sondern alle Carsharing-Anbieter betrifft, die minutengenau abrechnen. Da jede Minute zählt, fahren die Fahrer damit hier in Mitte ziemlich rüpelhaft, so wirklich gar nicht nach §1 der Straßenverkehrsordnung. Die Fahrzeuge werden dann manchmal saumäßig eingeparkt, bzw. hingestellt. Immerhin, vier Minuten sind ein knapper Euro. Da fährt man doch lieber agressiv, als dass man noch jemand vorbei lässt. Insbesondere Fahrzeuge von DriveNow fallen diesbezüglich negativ auf. Ein generelles Problem, das gelöst werden muss.
Interessanter als den Minutentarif finde ich, dass die Miete eines Multicity-Cars mit 39 Euro pro Tag gedeckelt ist. Mit einem voll geladenen Multicity kann man also gute 100 km – die Reichweite, die das Elektroauto hat, wenn der Akku nachher noch 10% Restladung haben soll – fahren, ohne zusätzliche Energiekosten. Muss man drei oder vier mal hin und herfahren, kann das durchaus die Alternative zum Taxi sein. Ein Guthaben von 10 Minuten bekommt man, wenn man ein Auto mit weniger als 50% Akkuladung an eine Strom-Tanksäule anschließt. Absolute Pfennigpfuchser können gezielt diese Halbentladenen zum Tanken fahren und sich damit scheibchenweise Hauptstadtmobilität sichern. Den Ladestatus erkennt man in der Multicity-App, die den Standort des Autos anzeigt. Das ist durchaus wichtig, weil man ja planen muss und schätzen, ob ggf. die Fahrt von Mitte bis Zehlendorf und zurück mit einem ziemlich entladenen Akku noch möglich ist oder ob man ein paar Schritte weiter läuft und ein Auto mit besser aufgeladenem Akku nimmt.
Geschäftsgebiet
Darunter wird das Stadtgebiet verstanden, aus dem man zwar herausfahren kann, aber in dem man das Auto unbedingt wieder abstellen muss. Vermutlich, weil nur hier Strom-Tanksäulen sind und die Autos im Innenstadtbereich bleiben sollen, damit das Serviceteam sie notfalls schnell an die Ladesäulen fahren kann. Außerdem, damit Autos nicht im Außenbereich herumstehen, wo keine oder nur ganz wenig potentielle Nutzer sind. Zum Geschäftsgebiet kann ich einfach nur sagen. Klein, zu klein. Zumindest was den Berliner Norden angeht. Zum Kaufland nach Pankow komme ich sicher mit einem Multicity, kann es dort zwar parken, aber nicht aus-checken. Die Zeit läuft also weiter, 28 Cent pro Minute, bis 39 Euro voll sind. Nach Reinickendorf, wo ich oft Halbtagstermine habe, muss ich weiterhin die U8 mit ihrem gewöhnungsbedürftigem Publikum benutzen. Schade.
Betatests und Betatester
Eines ist mir noch einmal bewusst geworden, als ich den Autoscooter getestet habe, und das hat nichts mit Multicity direkt zu tun, sondern trifft auf alle Carsharing-Anbieter zu. Da ist vieles in Betatest-Phase, konzeptionell und technisch. Das ist auch in Ordnung so, da teste ich gerne mit.
Sterne
dreikommafünf von fünf
Links