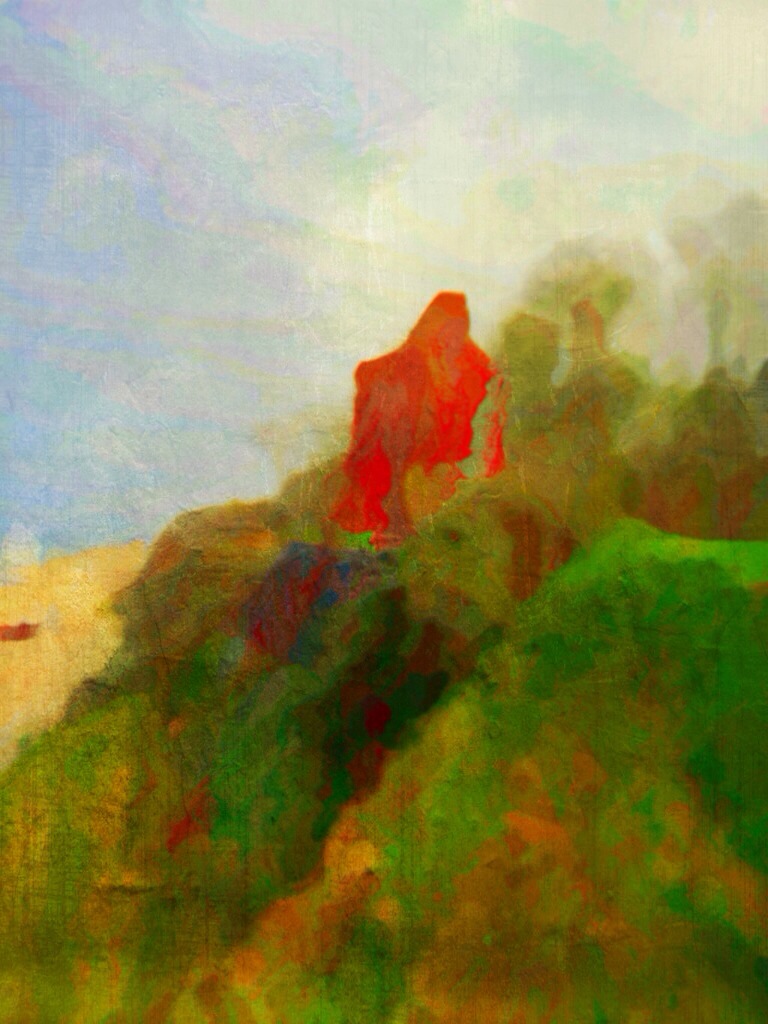Dezember-Sonnenstrahlen im Grunewald einfangen — Adventskranz-Variationen — Hauptstadtspaziergang — Herrenkekse — Das Haus gegenüber.
Adventskranz
Digital, nadelt nicht – #sosimple
Heute ist der erste Advent, und spätestens jetzt ist auch mit viel Ignoranz klar, dass bald Weihnachten ist. Viele Jahre war mir dieser Weihnachtstrubel zuwider. Ich bin diesbezüglich jedoch nicht allein. Vielen Menschen ist dieses Vorweihnachtsgehuddel nicht angenehm. Ich persönlich bin beeinflusst durch die Weihnachtsvorbereitungen in meiner Ursprungsfamilie. Alles musste dort perfekt sein. Dazu nicht ein Adventsgesteck, sondern in jedem Raum eines, damit alles schön weihnachtlich wird, für das große »Fest der Liebe«. Vielen aus meiner Generation geht es genauso, mit unseren westdeutschen Müttern, die ihrem Job als Hausfrau nachgingen.
Natürlich gab es in meinem Umfeld auch Familien, die immer ein richtig großes Weihnachtsfest feierten, oft der Familientreff des Jahres. In unserer kleinen Familie war das nicht so. Alle sahen sich sowieso jeden Tag. So hatte das Weihnachtsfest selten richtige Herzlichkeit und die Weihnachtsvorbereitungen waren oft mehr mit selbst gemachtem Stress und Gerädertheit verbunden, als mit Gelassenheit und Freude. Die Familien mit vielen Geschwistern der Kinder und Eltern habe ich immer beneidet. Bei ihnen war vieles sichtbar weit weg vom Perfektionismus, was bei den vielen Personen auch gar nicht anders gehen konnte. Bei uns war es anders. Bei uns war alles schön. Scheinbar. So hab ich die Weihnachtsvorbereitungen und das Weihnachtsfest in meiner Kindheit und Jugend nicht in positiver Erinnerung.
Nach meinem Auszug zum Studium befreite ich mich sofort von diesem Weihnachtsgedöns. Mit einer Ausnahme, denn eine meiner Freundinnen war christlich engagiert, gab es in all meinen Studentenwohnungen und -WGs keinen Weihnachtsbaum und kein Adventsgesteck. Im Laufe der Jahre wurde mein Umfeld erwachsen und ich auch. Freunde und Bekannte bekamen Kinder und manch einer kam tatsächlich aus so einer Großfamilie, wo Weihnachten »nach Hause« zu fahren einem großen Familientreffen gleichkommt, auf das sich die Betreffenden schon Wochen vorher freuen. Andere unternehmen in der Vorweihnachtszeit mit den eigenen Kindern viel und freuen sich daran, wie sich ihre Kinder darüber freuen. Über Helloween, Martinssingen, Laternenumzüge, Kekse backen, Adventsgestecke basteln, gemeinsames Adventsingen mit Kindern und Eltern und über das Basteln von Weihnachtsgeschenken. Alles das, was in meiner Kindheit oft mit Stress, Ungeduld und dem Druck, nichts falsch zu machen, verbunden war. Durch die Erfahrungen, dass es Menschen gibt, denen diese Zeit etwas bedeutet und die sich herzlich ungestresst und ohne Anspruch nach irgendetwas, mindestens nicht nach Perfektion, darüber freuen, kann ich diese Zeit heute selbst ganz gut genießen.
Meine letzte Beziehung konnte mit Weihnachten genauso viel anfangen ich damals noch, nämlich fast gar nichts. Jetzt wohne ich schon drei Jahre mit Miz Kitty zusammen und bin längst mit ihr verheiratet. Sie als Weihnachtsenthusiastin zu beschreiben wäre um 180 Grad verdreht. Sie hat viele Jahre Weihnachten recht außergewöhnlich verbracht. So kommt es, dass hier zwar Weihnachtskekse und Stollen gebacken werden, – weil gut, lecker und selbstgemacht – wir jedoch am ersten Advent weder einen Adventskalender noch Adventskranz oder -gesteck haben.
Freilich, hier gibt es Kerzen und Teelichter galore. Brauchen wir jetzt noch einen Adventskranz mit Tannennadeln, Zapfen und die Kerzen in kitschigem Rot? Manchmal konterkariere ich solche Situationen. Zum Beispiel, indem es dann doch den kitschigen Adventskranz mit roten Kerzen, Schleifchen, Nadelgewächs und Zäpfchen gibt. Das tue ich in diesem Jahr nicht. Während Kitty gerade sagt, »Können wir morgen noch kaufen,… ist morgen billiger, weil der erste Advent schon rum ist« nerde ich heute lieber digital rum, um doch noch die roten vier Kerzen ins Wohnzimmer zu bekommen. So habe ich einen digitalen Adventskranz kreiert. Nicht nur für uns, auch für Sie, falls ihre Wohnung noch unweihnachtlich anmutet und ihre westdeutsche Mittelschichtsverwandtschaft christlicher Prägung sich zum Besuch angesagt hat.
Einfach das MacBook aufklappen oder den Computer der Wahl starten, diesen Internetlink aufrufen und fertig. Sie finden bestimmt noch ein Internetradio mit Adventsliedern und die Kekse bringt dann hoffentlich Ihr Besuch mit.
Viele Vorzüge hat der digitale Adventskranz. Er nadelt nicht. Er zeigt Ihrem nicht computeraffinen Besuch, was man mit Computern alles machen kann und dass das teure MacBook Pro in Ihrer Studentenbutze oder in Ihrem Atelier sinnvoll eingesetzt ist. Weiterhin brauchen Sie keine Streichhölzer zum Anzünden zu kaufen. Ich wäre nicht @GrafTypo, wenn nicht ganz automatisch am zweiten Advent dort zwei Kerzen brennen würden und am dritten drei. Sie müssen also nicht einmal überlegen, der wievielte Advent gerade ist und outen sich nicht als Advents-Banause, der am dritten Advent erst zwei oder schon alle vier Kerzen anzündet.
Mit einem Browser, der die Internetseite im Kioskmodus, d.h. im Vollbildmodus ohne Symbolleisten, anzeigt, sieht es so wie auf dem Foto aus – ohne störende Adresszeile. Der Google-Chrome-Browser kann diesen »Präsentationsmodus« darstellen. Verwenden Sie entweder Chrome oder googlen Sie einfach, wie Ihr Browser im Kioskmodus funktioniert. Oder laden Sie sich einen speziellen Kioskbrowser, mit dem Sie den Link zum digitalen Adventskranz aufrufen. Auf dem iPad funktioniert der erweiterte Vollbildmodus zum Beispiel mit dem Atomic-Web-Browser.
Dann feiern Sie mal schön Advent und lassen es sich gut gehen.
Novemberausblick
Wie immer ist der November der Herbstmonat mit der großen Tristesse. Die Tage werden merklich kürzer, und es wird manchmal nur wenig hell. Kahl, trist, farblos, unbunt – vieles könnte jetzt heller und wärmer sein. In fünf Wochen ist Weihnachten, was uns in diesem Jahr wieder keiner rechtzeitig gesagt hat. Die Stollen sind hier bereits gebacken und eingelagert und morgen kommt das Kekskommando für die Weihnachtsplätzchen. In einer guten Woche wird dann noch ein großer Tisch geliefert. Viele Dinge laufen gerade parallel.
Für alle, mich auf Twitter nicht regelmäßig lesen, habe ich die November-Skyline, die man hier aus Büro und Wohnung sieht, als Foto eingestellt. Novemberfarben. Noch ist kein Schnee, und das ist gut so. Ich mag keinen Schnee in dieser Stadt.
Kreditkarten-Upcycling
Diesen Beitrag lesen Sie am besten nur weiter, wenn Sie das sogenannte »Kreativ-, Bastel, und DIY-Gen« haben, Papier also nicht nur mit Computer und Laserdrucker beschreiben und Ihnen Bleistift und Buntstift nicht fremd sind.
Vor einem Monat lief meine alte Kreditkarte ab. Selbstverständlich bekam ich rechtzeitig eine neue zugeschickt. Eigentlich soll man die alte Karte sofort zerschneiden, damit sie nicht noch irgendwie missbräuchlich verwendet wird. Oft hebe ich diese Plastikkarten jedoch auf, eignen sich sie doch hervorragend als flexible Flachspachtel, egal ob man damit Leim auf einer Oberfläche verteilt oder kleine Fugen und Risse mit Spachtelmasse verschließt.
Vorhin hatte ich jedoch eine andere Idee, da auf der Kreditkarte neben der Nummer auch mein Name richtig eingeprägt ist. Hochprägung nennt man das im Kreditkarten-Jargon. Früher™, als es noch keine elektronischen Lesegeräte gab, war diese Hochprägung unbedingt erforderlich. Mit einem Imprinter, vulgo Ritsch-Ratsch-Gerät, wurde die geprägte Kartennummer in ein Durchschreibepapier übertragen. Heute gibt es diese Imprinter nur noch selten. Trotzdem – oder eben für den seltenen Fall – haben nach wie vor alle Kreditkarten die Hochprägung. Bevor ich die Karte entsorge, so dachte ich, müsste sich damit doch mein Name in ein Blatt Papier einprägen lassen, z.B. für ein Exlibris in einem Buch. Freilich möchte ich jedoch nur meinen Namen damit einprägen und nicht meine Kreditkarten-Nummer. Deswegen muss zuerst die Kartennummer und das Ablaufdatum verschwinden. Schnell ist beides mit dem Cuttermesser entfernt. Etwas Fingerfertigkeit ist dafür schon erforderlich, schneiden Sie sich also nicht in die Finger, der Kunststoff der Kreditkarte ist ziemlich hart. Wer mit dem Cutter umgehen kann, hat es jedoch in fünf Minuten erledigt. Damit keine erhabenen Rückstände übrig bleiben, kann man ggf. noch etwas mit feinem Schleifpapier nacharbeiten. So drücken sich garantiert keine Reste mehr ins Papier. Aufpassen muss man, dass man den Namen nicht gleich mit abschneidet. Und wenn, ist es auch egal, die Karte hätten Sie ohne diesen Blogpost sowieso weggeworfen?
Ist nur noch der Name vorhanden, stellt sich die Frage, wie man diesen in ein Blatt Papier gedrückt bzw. geprägt bekommt. Den weichen Handballen, eine Gummisohle oder ein größeres Radiergummi dafür zu verwenden, ist naheliegend, jedoch keine gute Idee. Bekanntlich ist Druck ja Kraft pro Fläche. Ist die Fläche klein, braucht man nicht viel Kraft, um großen Druck ausüben zu können. Das kennen Sie alle von der Stecknadel, die an der Spitze eine so kleine Fläche hat, dass man mit recht wenig Kraft in festes Material eindringen und es durchstechen kann. Legt man die Karte also unter ein Blatt Papier und drückt mit einem Radiergummi oder einer Gummisohle von oben auf das Papier, so ist das Ergebnis der Prägung nur mäßig. Die Fläche, mit der der Druck ausgeübt wird, ist zu groß. Man bräuchte die Kraft einer richtigen Presse. Besser geht es wie abgebildet mit einem Bleistift-Radiergummi. Es hat eine viel kleinere Fläche. Natürlich muss man damit mehrmals pressen. So gelingt es jedoch, nacheinander jeweils ein bis zwei Buchstaben schön ins Papier zu übertragen. Etwas Probieren ist freilich immer dabei, bis man einen schönen Bleistift gefunden hat, dessen Radiergummi sich gut für diesen Zweck eignet. Wer DIY mag, der probiert ja sowieso oft gern. Das Papier ein wenig anzufeuchten, ist eine Variante, die Erfolg verspricht, wobei man aufpassen muss, dass es sich nicht wellt, wenn es wieder getrocknet ist oder die Oberfläche beschädigt ist. Bei meinem Test habe ich es nicht feucht gemacht und ein gutes Ergebnis erzielt (siehe Fotos).
Die feinen Strukturen, die man mit einer Prägezange oder einem Prägegerät erreicht, bekommt man mit diesem Kreditkarten-Upycling nicht hin. Falls Sie also Ihren Namen makellos in der Schrift Ihrer Wahl prägen möchten oder ohnehin eine Bastelphobie haben, dann führt Ihr Weg zum örtlichen Stempel- und Gravuren-Hersteller oder vielleicht zu Manufactum. Was jedoch mit der upgecycleten Kreditkarte im Gegensatz zum Prägegerät möglich ist, ist das Sichtbarmachen der Buchstaben, indem man das Papier vorsichtig mit dem unlackierten Holzbleistiftende (wie bei Ikea-Bleistiften), mit Wachsmalkreide oder behelfsweise auch mit einem lackierten Bleistiftende frottageartig abreibt. Das Ergebnis wird immer etwas rough sein, aber das ist gerade der Reiz dieses Kreditkarten-Upcycling. Makellos-clean können Sie Ihren Namen mit dem Laserdrucker oder mit dem Gummistempel für ein paar Euro stempeln.
Ost-West-Deutsche Paare
25 Jahre sind seit der Grenzöffnung durch die DDR vergangen. Seitdem hat sich viel getan in Deutschland. Manche Menschen hätten sich ohne dieses Ereignis und die Deutsch-deutsche Vereinigung nie kennengelernt. Andere wären nie ein Ehepaar geworden. So z.B. Miz Kitty und ich. Miz Kitty ist in der DDR aufgewachsen, ich in der alten BRD. Aus diesem Grund sind wir seit gestern Bestandteil einer Kunstaktion. Sabine Welz von Art Domino hat 25 Ehepaare im Pop-Art-Stil auf Leinwand gebracht, von denen jeweils der eine Partner aus dem Osten und der andere Partner aus dem Westen kommt. Aneinandergereiht wie Dominosteine ergibt sich ein großes Kunstwerk von 5 mal 2,5 Meter. Die Kunstinstallation ist noch bis zum 11. November im Berliner Europa-Center neben der Uhr der fließenden Zeit zu sehen.
Und jetzt möchten Sie wissen, wo unsere Portraits in dem Geamtwerk sind? Nun, schauen Sie sich meinen Twitter-Avatar an, dann finden Sie mich, auch ohne Propeller.
Die DDR, der Mauerfall und ich
Vor 25 Jahren
Heute ist der 9. November 2014. Vor 25 Jahren öffnete die DDR nach einigem hin und her die Grenze zu West-Berlin und zur alten Bundesrepublik. Ein historischer Tag.
Ganz Berlin scheint in diesen Tagen auf den Beinen zu sein. Auf einem Teil des ehemaligen Verlaufs der Berliner Mauer sind gasgefüllte Ballons dicht an dicht aneinander gereiht, eine Lichtinstallation, die Lichtgrenze. Heute, am Jahrestag der Grenzöffnung werden sie nach und nach in den Himmel fliegen. Die Grenze löst sich auf und verschwindet. Gestern und vorgestern Abend waren viele Berliner an dieser Lichtgrenze unterwegs, mit Kind und Kegel. In der historischen Mitte der Hauptstadt, an der Bernauer Straße, im Mauerpark und natürlich an der Bornholmer Straße, dort an der Bösebrücke, wo die Grenze zuerst geöffnet wurde. Die Berliner zieht es immer schnell zu Events und zu diesem erst recht. Manchem steht das Déjà-vu ins Gesicht geschrieben.
Seit 1998 lebe ich in Berlin, und schon fast zehn Jahre hier in Berlin-Mitte, am Zionskirchplatz. Die Bernauer Straße, dort wo ich dieses Foto gestern machte, ist von unserer Wohnung fußläufig schnell zu erreichen. Es ist die Straße, die Mitte bzw. Prenzlauer Berg vom Wedding trennt, die ehemalgige Sektorengrenze. Dort, wo die Straße zum französischen Sektor gehörte, die anliegenden Häuser jedoch zum sowjetischen. Dort, wo im August 1961 Menschen aus den Häusern in den Westen sprangen, in die Sprungtücher der Westberliner Feuerwehr. Jeder, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, kennt die Bilder aus dem Geschichtsbuch.
Viele erinnern sich heute, was sie am 9. November 1989 gemacht haben. Ich studierte damals in Hannover. Der 10. November, also der Morgen danach, war dort ein trüber Herbsttag. Natürlich gab es in den Tagen und Wochen vorher immer wieder Berichte über die DDR, über Montagsdemonstrationen, die Prager Botschaft, die Ausreise über Ungarn, etc. Das alles interessierte mich schon, nur eben mit dem Stellenwert wie so viele andere Dinge auch. Einen wirklichen Bezug zur DDR, dem ostdeutschen Staat, hatte ich nämlich nicht. So lief ich am 10. November 1989 vom Hauptgebäude der Uni Hannover durch den kleinen Park zu den Institutsgebäuden am Schneiderberg. Ein Kommilitone kam mir entgegen und wir wechselten ein paar Worte. Er fragte dann: »Haste schon gehört, die Mauer ist offen in Berlin.« Ich hatte es noch nicht gehört und hatte freilich nichts von der Nacht auf der Brücke der Bornhomer Straße mitbekommen. Ok, jetzt war die DDR-Grenze offen. Eine Bedeutung hatte das damals für mich nicht. Nicht im Traum hätte ich mir ausmalen können, dass ich Jahre später ziemlich nah an Bernauer und Bornholmer Straße leben würde. In Berlin. Und noch weniger hätte ich mir ausmalen können, dass ich 25 Jahre später in meiner Wohnung stehe, mit einer Frau aus der Ex-DDR verheiratet sein würde und vom Ende der Veteranenstraße über die historische Mitte bis zu Funkstation Tempelhof schaue – vom alten Osten in den alten Westen. Dorthin, wo die Menschen in die alte BRD ausgeflogen wurden, die Berlin nicht auf dem Landweg verlassen konnten.
Berlin war für mich als westdeutsches Mittelstandskind weit weg, und die DDR, die war noch viel weiter weg. Meine Familie hatte keine Verwandten in der DDR. Daher war dieser zweite deutsche Staat auch für ein meine Eltern außerhalb ihres Fokus. Das war Ausland, weit beschwerlicher zu erreichen als Österreich. Warum sollte man sich dafür interessieren? So war meine Kenntnis als Schulkind über Orte in der DDR und in den deutschen, heute meist polnischen, Ostgebieten schnell besser als die meiner Eltern. Es gab mehrere Lehrer, die selbst aus der DDR und aus den deutschen Ostgebieten kamen. Sie erzählten uns viel über die deutsche Teilung, die DDR, ihre Erfahrungen dort (mit Ausreise, Flucht, etc.) und auch über die deutschen Ostgebiete in Polen. Freilich, immer mit dem Tenor, dort seien ungerechte Menschenunterdrücker am Werk, die Land und Leute drangsalierten, aber wir müssten gerüstet sein, das Land und seine Städte zu kennen, für den Fall, dass mit Amerika-Hilfe die Wiedervereinigung kommt und wir dann unseren deutschen Brüdern die Freiheit bringen – woran diese Lehrer Anfang der 70er Jahre wohl ernsthaft glaubten, dass es eintritt. Ich war ein neugieriges Kind und mich begeisterten diese Erzählungen über den Osten schon. Wie schön alles gewesen sei, dass wir uns an Amerika hängen müssten, damit die Menschen in der DDR – die Verwandten der Lehrer und Mitschüler – endlich nicht mehr eingesperrt wären, uns besuchen könnten, wann sie wollten und zu dem gleichen Wohlstand kämen wie wir. Seit dieser Zeit kenne ich – freilich nur vom Hörensagen – den Unterschied zwischen Thüringen und Sachsen und seitdem weiß ich, wo Schlesien, Pommern und das Wartheland liegt, dass Breslau in Schlesien ist und Königsberg in Ostpreußen. Kurze Zeit später kamen die 68er-Lehrer, die die DDR und die polnische Westgrenze sowieso als manifestiert ansahen und uns mitteilten, wie schlecht und ungerecht die Bundesrepublik mit ihrer RAF-Rasterfahndung sei und dass die Kommunisten im Osten nicht unsympathisch seien und gute, soziale Dinge täten. Nun, mit diesen Lehrern kam ich als angepasstes Schulkind sowieso nicht klar, aber das ist ein anderes Kapitel. Ihre Wirkung war jedoch begrenzt.
Herr Bergner kommt aus der Niederlausitz. Das sagte meine Großmutter einmal über einen Nachbarn. Niederlausitz, das klingt für ein Schulkind schon merkwürdig exotisch, zumindest wenn die Landschaften drumherum Westfalen, Weserbergland, Münsterland, Niedersachsen oder Sauerland heißen. Ich fragte also, wo das genau ist und bekam zunächst die Standard-Antwort: »Im Osten.« Wo denn da, in Polen oder in Russland? Mit ziemlich viel Aufwand fanden wir dann heraus, dass die Niederlausitz ganz im Osten der DDR, rund um Cottbus und Guben liegt. So habe ich es mir damals jedenfalls gemerkt.
Bei meinen Schulfreunden sah das anders aus. Einige hatten Verwandtschaft in der DDR, in Gera, in Leipzig oder in Dresden. Da war es in den 70ern ein Thema, Pakete an die Cousins und Cousinen zu schicken, diese zu besuchen oder zur Beerdigung Verwandter zu fahren – und natürlich nachher zu erzählen, wie viel schlechter und ärmlicher es denen geht, dass man sich aber gefreut habe, sie zu sehen und man jetzt dies und jenes kaufen werde, um Ihnen das zu schicken, weil es das dort nicht gäbe. Von einem Mitschüler bekam ich einmal hochwertige Spulen-Tonbänder geschenkt. Die Familie musste sie bei der Einreise in die DDR zurückschicken, sie waren für die Verwandten bestimmt und durften nicht eingeführt werden. Nun waren sie übrig und ich bekam sie geschenkt, da die Familie selbst kein Tonbandgerät hatte. Es waren wohl die (relativ) teuersten und hochwertigsten Tonbänder, die ich jemals besaß. Gut kann ich mich daran erinnern, dass Dinge, wie Pakete nach drüben zu schicken, zu meiner Grundschulzeit auf den Kindergeburtstagen ein Thema waren. Ich habe den Eindruck, dass dieses in den späten 70ern und 80ern nachließ. Mag sein, dass ich andere Schulfreunde hatte, die eben auch keinen oder nur wenig Bezug zur DDR hatten, es kann aber auch sein, dass in den späten 70ern die deutsche Teilung als gegeben hingenommen wurde und alle sich mehr im Westen etabliert hatten, die nahen Verwandten auch ausgereist oder schon gestorben waren und die Besuche seltener wurden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, oder ob es subjektive Wahrnehmung ist. DDR, Osten, Herkunft der Eltern, Verwandte dort, das waren zumindest auch für meine Schulfreunde in den 80ern keine relevanten Themen mehr, und für mich sowieso nicht.
Mein Interesse an der DDR, dem deutschen Osten, etc. war jedenfalls in den 80ern erloschen. Ohnehin wurde die DDR nur als graue, ungerechte Diktatur mit Mangelwirtschaft beschrieben, als ein Ort, wo man besser nicht hinfahren sollte, vielleicht ins Gefängnis kommt, etc. Als Teenager macht man sich dann schon seine Gedanken und kann auch schon einiges bewerten. »Das müssen komische Menschen dort sein, die ihre Mitmenschen einsperren und ihnen nicht erlauben, ihre Verwandten in der Bundesrepublik zu besuchen. Die es nicht mal zulassen, dass man ein unbespielttes Tonband mitnehmen darf. Ehrlich, was will man da?« So dachte ich.
Während einer von der Bundesrepublik finanziell geförderten Schülerreise war ich in West-Berlin und im trostlos-grauen Ost-Berlin. Mit diesem Berlin konnte ich wenig anfangen. Ich war kein Abenteurer. Ich wollte es am Liebsten so, wie zu Hause. Einige aus meinem Gymnasium zog es nach dem Abitur nach West-Berlin. Dorthin, wo man nicht zur Bundeswehr musste, wo alles alternativer, unkomplizierter und weniger bürgerlich war. Das interessierte mich nicht. Ich wäre dort hoffnungslos untergegangen. Zudem wurde mir von meinen Eltern vermittelt, bloß nicht in Berlin zu studieren, da man ja ständig über diese Transit-Strecke fahren müsse und man nie wisse was dort passiert. Was hätte passieren können, vielleicht waren da Menschenfresser hinterm Busch? Da mag auch noch die Erzählung des Vaters einer früheren Mitschülerin bei mir einen Eindruck hinterlassen haben, der nach West-Berlin nur noch per Flugzeug reiste, weil er unter problematischen Umständen die DDR verlassen hatte und das Risiko nicht eingehen wollte, bei einem Transit auf dem Landwege festgenommen zu werden.
Ich habe dann in Hannover studiert. Sie wissen schon, dort wo Deutschland am saubersten spricht, die Leute ordentlich sind, in den Mietshäusern die Menschen ihre Treppe abwechselnd selber putzen, mit Putzplan und Unterschriftenliste zum Abzeichnen und an den nächsten Nachbarn weiterzugeben. Und wehe, Sie haben die Liste einmal vergessen und einfach weggepackt. Hannover, ordentlich, korrekt, unprätentiös, nich auffallender Durchschnitt. Als die Grenze geöffnet wurde, waren auch in Hannover einige meiner Kommilitonen gespannt wie der Flitzebogen, was nun kommen würde und neugierig auf die DDR, auch auf die DDR-Mädchen und -Jungs. Diese Neugier war mir abhanden gekommen. Vielleicht lag es an Hannover, der Stadt mit meinen bittersten Zeiten, mit der ich immer noch keinen richtigen Frieden geschlossen habe.
Ich hatte jedenfalls kein Interesse, mir die DDR anzuschauen. Ich kannte dort keinen und hatte genug mit mir selbst zu tun. Mir reichte diese verstopfte A2-Autobahn, über die ich fahren musste, wenn ich meinen Heimatort besuchte. Komisch aussehende Menschen gedrängt in komischen Autos. Die komplette A2 war benebelt von den blauen Zweitakt-Abgasfahnen. Klar, da könnte man selbst auch mal rüberfahren, ein bisschen genauer schauen, irgendwann einmal.
Als die D-Mark längst eingeführt und die Grenze schon lange offen war, fuhr ich ein paar mal mit dem überfüllten Regionalzug Richtung Sachsen-Anhalt. Morgens hin, abends zurück. Mich triggerte da nichts, ich fand das nicht interessant. Der kleinbürgerliche hannoversche Kosmos, ein Abbild meines Elternhauses, hatte mich gefangen. Die allseitigen Klagen, es gäbe jetzt keine günstgen Gebrauchtwagen mehr, weil die Ostdeutschen alles weg kauften, die Klagen, dass man in Geschäften manches gar nicht mehr bekomme und die Klagen meiner Hildesheimer Auftraggeber, die Kunden und Lieferanten würden jetzt im Osten investieren und eigene Betriebe aufbauen, wodurch man als kleiner Mittelständler ins Gras beiße. Und was das alles koste. Die Ost-Familien wären jetzt mit der D-Mark alle reicher als man selbst, weil beide Partner berufstätig seien, beide Rente bekämen, usw., usw. Ich muss mir zugute halten, diese Weltsichten aus der Hannoverschen Kartoffelgalaxie nie geteilt zu haben. Ein Interesse am neuen deutschen Osten ergab sich dadurch jedoch erst recht nicht.
In diesem Kosmos war ich dann einer der wenigen, die sich dafür aussprachen, die Wiedervereinigung schnell zu vollziehen, wenn die Ostdeutschen das selbst wollten. Nicht aus deutsch-deutschem Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern ich hielt die Russen für unberechenbar und dachte, man müsse sofort Nägel mit Köpfen machen und eine große Bundesrepublik schneidern, bevor diesen Russen noch etwas anderes einfällt. Dass es 25 Jahre – und mancherorts länger – dauern würde, bis Landschaften blühen, das war mir klar und vielen anderen sicher auch.
Erhellend, erschreckend, ermutigend: Den ersten richtigen Ost-Kontakt hatte ich, als ich nach der Vereinigung Facharbeiter mit Berufsbezeichnung Ost zu Facharbeitern der gleichen Branche mit Berufsbezeichnung West umschulte. Von vorher arbeitslos zu nachher arbeitslos. Genauer gesagt habe ich einzelne Kurse im Rahmen dieser Umschulungen in Brandenburg gegeben. Das war erhellend, aber auch erschreckend. Und auch ermutigend.
Erhellend, wie die Situation zwei Jahre nach der Grenzöffnung wirklich aussah. Erhellend über westdeutsche Interessen und die Mechanismen des Kapitalismus. Und erhellend über die ostdeutsche Verhaltensweisen. Erschreckend, wie viel Westprodukte dort in den Regalen lagen. Es sah so aus, als ob dieser untergegangene Staat keine Waren- und Marken-Vergangenheit hatte. Stellen Sie sich vor, Sie tauschen jetzt Ihre Euro-Scheine gegen eine andere Währung und sämtliche Waren und Dienstleistungen werden in relativ kurzer Zeit durch andere, manchmal nur vermeintlich, oft aber tatsächlich bessere, in der Regel aber buntere, ausgetauscht. Das Ganze natürlich im alten, nicht so schnell änderbaren Ambiente der bröckelnden Fassade und mit den alten Akteuren. Erschreckend, diese Kombination aus tradierten Ost-Verhaltensweisen, einer Orientierungslosigkeit, Frühkapitalistischen Gegebenheiten und bunter Markenwelt. Zum Besserwessi taugte ich damals nicht. Dazu bin ich zu zurückhaltend. Es mag sein, dass dieses die Ursache war, warum ich bei meinen Einsätzen in der brandenburgischen Provinz immer sehr herzlich und freundlich empfangen wurde. Das war ermutigend für mich. Ermutigend, mich mit der DDR zu befassen. Mir die Gegend anzuschauen, was dort so möglich ist. Und mitzuerleben, was sich dort entwickelt. Kontakte zu netten Menschen zu knüpfen und vielleicht dort einmal dauerhaft zu arbeiten.
Kurze Zeit später hatte ich mein Studium beendet und zog nach Hamburg. Hamburg, dieses Tor zur Welt mit Elbe und Alster, großen Schiffen, den mir mental nicht fremden Menschen, ein Ort, an dem vieles etwas gediegener und ästhetischer ist als im Rest der Republik, egal ob in Ost oder in West. Diese Stadt rockte für mich und Norddeutschland sowieso. Ich fand schnell Anschluss und eine nette Hausgemeinschaft. In dieser Stadt, dachte ich, bleibe ich den Rest des Lebens. Nur, es gab dort ein anderes Problem. Zufällig verschlug es mich nach Berlin, die Ereignisse überschlugen sich im Positiven und ich blieb hier.
Ein paar Jahre nach dem Mauerfall gab es hier in Berlin im Osten noch den Osten und im Westen noch den Westen und die Mitte war eine Kombination von Aufbruch und Gammel. Vieles gab es hier zu entdecken und mit meiner damaligen Freundin entdeckte ich, ziemlich viel und immer mehr. Schön, wie sich hier alles entwickelte. Und ich mittendrin, glücklich. Ich machte einen Quantensprung, und Berlin machte auch einen Quantensprung, hin zum Internationalen. Und dann noch einen, hin zur Ästhetik. Leider ist letzteres oft mit Gentrifizierung verbunden. Erst und moderat fand ich sie gut. Alles wurde so schön, nobel, und edel, mit internationalem Flair. Inzwischen kommen mir ernsthafte Zweifel.
Freilich, es gibt sie noch, die Ost-Stadtteile, die man eindeutig als Osten wahrnimmt und die West-Stadtteile, die man als Westen wahrnimmt. Die Metropole hat jedoch längst andere Kategorien: Berliner, Schwaben, deutschsprachig, englischsprachig, international, mit Migrationshintergrund oder ohne.
In 25 Jahren, am 9. November 2039. Wer weiß, wo wir dann leben? Wenn alles so gut wird, wie es wurde, dann ist es gut.
Rasterpunkte holen
Rasterpunkte holen, …und noch ein WLAN-Kabel mitbringen.
Gerade sagte hier jemand das Wort WLAN-Kabel, und wir lachen alle herzlich. Früher™, als es noch kein WLAN gab und ich noch in Hannover und Hildesheim unterwegs war, schickte man die Lehrlinge und Schüler-Praktikanten los, um beim örtlichen Händler für grafischen Bedarf Letraset-Anreibebuchstaben zu kaufen und gab ihnen in den ersten Arbeitstagen mit auf den Weg, außerdem noch einzelne Rasterpunkte mitzubringen. Zurück kamen sie dann zuweilen mit einer schön zurechtgemachten Tüte mit Papier-Konfetti aus dem Bürolocher darin. Ein Mitarbeiter des Grafikbedarfladens hatte das Spiel mitgespielt und noch eins draufgesetzt.
Freilich wurde der Lehrling erneut losgeschickt, eine andere Größe zu holen. Eine Kollegin – sie arbeitet in der Druckvorstufe einer mittelständischen Druckerei – erzählt, das gebe es noch heute. Da würden die Drucker-Azubis – pardon, heute heißen sie Medientechnologen – aus dem Drucksaal in die Vorstufe geschickt, um einmal Rasterpunkte zu holen. Und natürlich bekommen sie auch dort Papier-Konfetti aus dem Locher. Der Rest ist auch der gleiche wie früher: falsche Größe, erneutes Losschicken, um sie in der richtigen Größe zu besorgen, jetzt in die Buchbinderei.
Azubi-Verarsche. Wir lachen gerade darüber. Rasterpunkte kaufen, ein WLAN-Kabel kaufen, den unterbelichteten Schülerpraktikanten zum Einkaufen schicken und ihm auftragen, er solle nach Haumichblau fragen, das gäbe es nicht im Regal, er müsse danach fragen. Lustig oder auch nicht lustig, dieses Verarschen Unwissender, die es später, wenn sie selbst zum Kreis der Wissenden dazugehören, an die nächste Generation weitergeben. Gerade haben wir uns ziemlich darüber amüsiert. Lustig ist es trotzdem nur mit Abstand oder wenn man darüber redet, ohne konkrete Personen im Sinn zu haben.
Späßken – wie man im Westfälischen sagt –, die früher vielleicht ganz gut in die Arbeitswelt passten. Damals™, als alles noch in ruhigeren, weniger effizienten, oft autoritäreren Bahnen und mit größerer sozialer Kontrolle verlief. Damals™ mögen diese Späßken gepasst haben, als die Arbeit noch körperlich anstrengender war, die Mitarbeiterzahl größer und die Arbeitsdichte deutlich geringer, so dass ein Lehrling Stunden damit verbringen konnte, Rasterpunkte zu besorgen. Heute passt es nicht mehr, so meine Schlussfolgerung, nachdem ich etwas länger über dieses Rasterpunkte kaufen nachgedacht habe. Es passt nicht mehr dazu, wie wir uns heute den Umgang miteinander idealer Weise vorstellen. Nicht einmal als Konter auf pubertäres Verhalten.
Heute haben wir die hochverdichtete Arbeitswelt mit zunehmender Individualisierung, basierend auf Marktgesetzen, Konkurrenz – mit deutlich weniger kollegialen Korrektiven, was Charakter und insbesondere problematische Verhaltensweisen anbelangt. Und heute haben wir Erkenntnisse über Traumatisierungen, das Entstehen von Mobbing und die Überzeugung, dass es gut ist, Dinge demokratisch zu gestalten – auch wenn diese Überzeugung noch nicht im Handeln umgesetzt ist, so ist sie doch zumindest im Wissen vorhanden. Bestimmte Dinge passen da nicht mehr. Zum Beispiel, Kriege zu führen. Oder Azubi-Verarsche im größeren Stil. Auch, wenn es im Nachhinein alle Beteiligten lustig finden. Nennen Sie mich einen Spielverderber, wo ich mich doch vorhin selbst noch köstlich über über die Schilderung des Azubi mit der Dose, »in der die Rasterpunkte aufgelöst sind«, amüsiert habe und mir jetzt der Spaß wegbleibt. Da bin ich gerne Spielverderber. Manche Spiele waren noch nie gut.
Die falschen Rasterpunkte werden durch die wahren Rasterpunkte abgebildet.
Helligkeiten bzw. Graustufen werden erzeugt, indem viele kleine Punkte unterschiedlicher Größe nebeneinander platziert werden. Das sind sie, die wahren Rasterpunkte. Jedes gedruckte Bild enthält sie, Millionen, Milliarden. Man kann sie weder weder anfassen noch kaufen.
In jeder Branche scheint es abstrakte Fachbegriffe zu geben, die einem unbedarften Anfänger suggerieren, man könnte sie anfassen, einkaufen, holen, etc. und die seit vielen Jahrzehnten Gegenstand dieser Lehrlings-Verarsche sind.
Ich durfte sie übrigens nicht kaufen und auch nichts anderes besorgen, was es denn gar nicht gibt. Ich kam erst mit den frühen Macs in die Druckerei- und Druckvorstufenwelt. Ich brachte die sogar mit – und erlebte ganz nebenbei das fleißige Rasterpunktholen.
Trzęsacz (Hoff)
Die Rückwand der Kirche
Über den Ausflug an die polnische Ostseeküste hatte ich schon in meinem letzten Beitrag geschrieben. Bei deutlich wärmeren Temperaturen als am Vortag geht es am Sonntag Mittag nach dem Frühstück im Palac Ptaszynka noch einmal nach Rewal, zur Kirchenruine Trzęsacz (Hoff), einen guten Kilometer westlich von Rewal.
Die Ruine ist eine Sehenswürdigkeit. Kirchenruine ist vielleicht etwas übertrieben, denn von der Kirche steht nur noch ein Teil der Rückwand. Anders als bei den zahlreichen Ruinen in Polen sind hier nicht Kriegsereignisse die Ursache, sondern ganz einfach die Natur und der Lauf der Dinge. Vor Jahrhunderten stand die Kirche 2 km von der Küste entfernt. Die Ostsee nahm sich das Land und rückte immer näher an den Bau heran, bis 1874 der letzte Gottesdienst dort war. Die Kirche wurde geräumt und der Natur freigegeben. 1901 war dann schon die vordere Wand komplett eingestürzt.
Es handelt sich hier um einen Ort, zu dem viele Menschen immer wieder hinfahren (u.a. Lionel Feininger hat diese Ruine gemalt). Hat man die Ruine vor zehn Jahren noch über ein einfaches Treppengestell vom Strand aus erreicht, so gibt es heute eine übergroße Aussichtsplattform inklusive einer leicht futuristisch anmutenden Zufahrtsstraße mit in den Boden eingelassenen Leuchten. EU-Finanzierung macht’s möglich. Etwas viel Aufwand um die Reste einer durch Naturgewalt ins Meer gestürzten Kirche, die schon lange zuvor nicht mehr in Berieb war. Dass das Meer manchmal landeinwärts rückt und sich so manches holt, ist Lauf der Dinge und zuweilen auch ganz gut so, entstehen so doch neue Dinge. Dass solche Prozesse Touristen und Einheimische anlocken, ist schön. Naturgemäß sind diese Prozesse jedoch irgendwann beendet. Muss man diese natürlichen Vorgänge dann mit viel Aufwand so stoppen, damit ihre Reste – hier die Kirchenrückwand – noch ein paar Jahrzehnte länger zu besichtigen sind?
Vielleicht ist es aber ganz gut für Sie, wenn Sie in Berlin oder in Norddeutschland wohnen und die polnische Ostseeküste noch nicht kennen. Dann ist Trzesac (Hoff) auf jeden Fall ein Ausflugspunkt. Rewal ist nicht weit. Im Sommer ist es vermutlich sehr crowded und unkommod dort, im Herbst und Winter können Sie dort jedoch kilometerweit spazieren gehen und die Ostsse genießen – ganz ohne die deutsche Kurtaxe.
Größenverhältnisse: Die Kirchenruine und ihre Aussichtsplattform.
Kirchenruine von Trzęsacz / Hoff (unbekannter Künstler)
Kontinuität: Jedes Mal, wenn ich nach Rewal komme, liegen diese typischen Fischerboote im Sand. Immer wieder ein interessantes Fotomotiv mit Urlaubsgefühlen. Schöner wie hier natürlich an einem sonnigen Herbstnachmittag und nicht nur mit dem iPhone fotografiert.
Genau. Da können Sie sich dann hinter stellen und ein Facebook-Foto machen. Oder Sie machen es mit Photoshop.