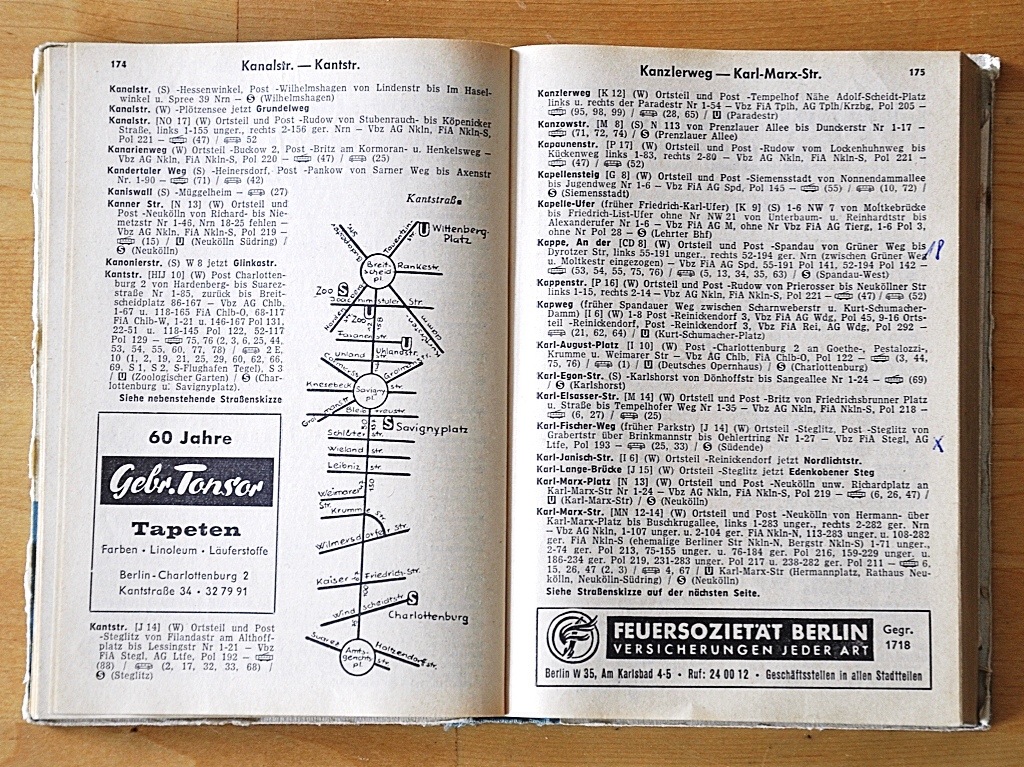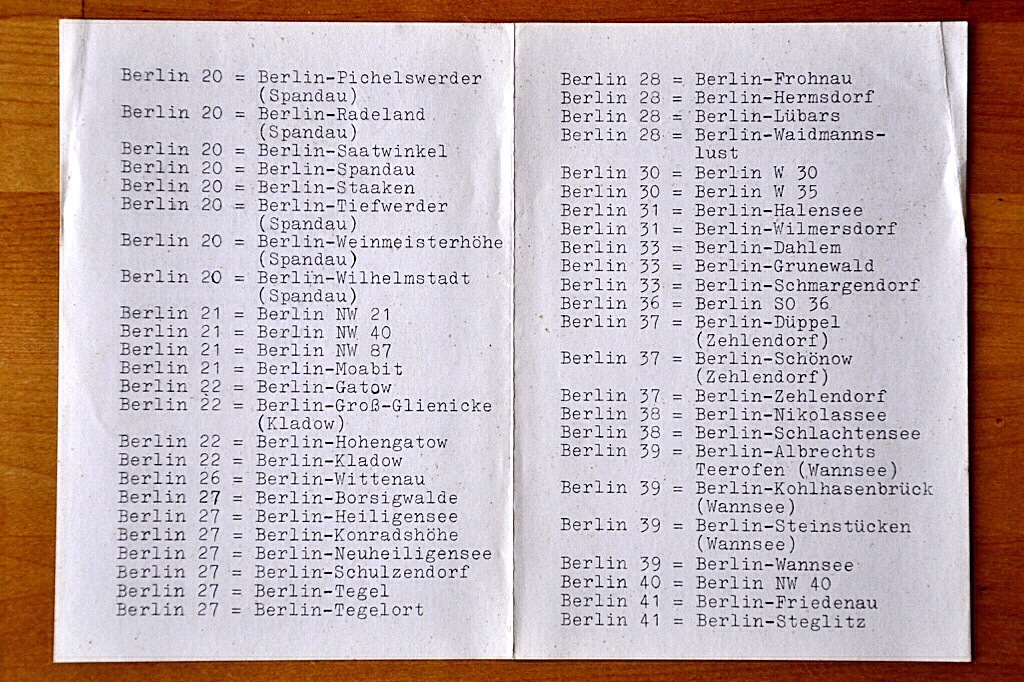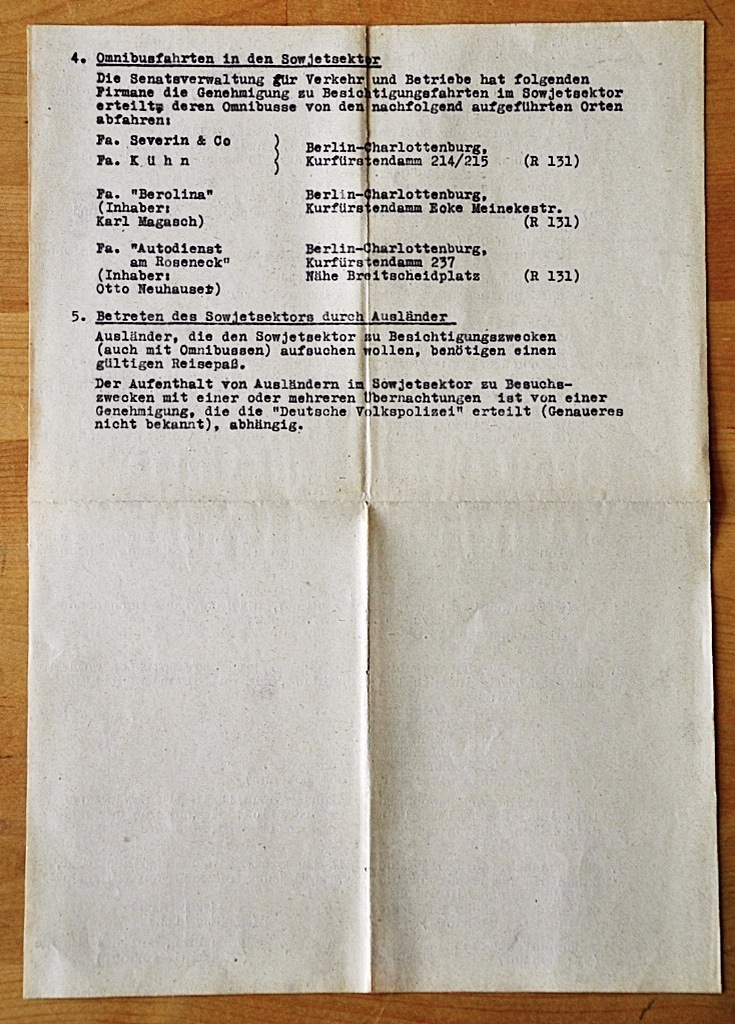Nie war Publishing so einfach wie heute
Vor ein paar Tagen wurde ich gefragt, ob ich einmal den neuen E-Short-Service von →BoD testen möchte. Natürlich, gerne, ich war neugierig, denn ich sage ja immer, dass Publishing nie so einfach wie heute war. BoD ist Kooperationspartner dieses Blogbeitrags.
BoD — Books on Demand
BoD, Books on Demand gibt es schon ziemlich lange und ist sicher vielen bekannt durch das Print-on-Demand-Konzept. Bücher werden erst gedruckt, wenn ein Kunde sie im Online-Shop bestellt. Mit dem Aufkommen des Digitaldrucks wurde der preiswerte Druck eines Buches ab der Auflage 1 möglich, also ein Einzelstück. Warum also nicht erst drucken, wenn der Kunde bestellt? Ok, in der Anfangszeit waren diese Bücher von minderer Qualität, heute sind sie vom massenproduzierten Taschenbuch oder Hardcover nicht mehr zu unterscheiden. Jedes individuelle Fotobuch und viele Taschenbücher, die man nicht in der Buchhandlung kaufen kann, sind nach diesem Verfahren produziert.
BoD war einer der ersten großen Anbieter dieses Print on demand und bietet dazu Verlagsdienstleistungen an (ISBN, Eintrag ins →VLB, damit das Buch von jedem Buchhändler bestellt werden kann, etc.). Heute gibt es bei BoD jedes Buch auf Wunsch auch zusätzlich als eBook.
Inzwischen ist auch der Markt aufgeteilt. BoD, epubli, und einige andere sind zu festen Größen geworden. Das Books-on-demand-Konzept – anfangs als Heilsbringer für Special-Interest-Titel und Autoren, die zuvor niemals gedruckt worden wären, gehyped – ist etabliert und Normalität geworden.
Jetzt. Endlich, digital, eBooks
Ganze Bücher am Bildschirm zu lesen, das erschien noch vor fünf Jahren als NoGo und mindestens nicht massentauglich. Klar, es gab Blogger, die längere Texte schrieben im Netz schrieben und IT-affine Nerds, die Bücher als Textdateien am Monitor oder auf den frühen Handheld-Computern wie Palm, Psion oder HP Journada lasen. Lesegenuss war es nicht, und es gab durchaus Forschungen, die nachwiesen, dass das Auge beim Lesen von Schrift auf grob aufgelösten Monitoren und Displays schneller ermüdet als beim Lesen gedruckter Schrift. Feine Serifenschriften können heute immer noch nicht so gut wie gedruckt am Monitor dargestellt werden, es sei denn, man hat ein Retina-Display. Hatten Palm, Psion, und Co noch diese grottenschlechten Displays, ist diese Retina-Auflösung heute bei mobilen Geräten Quasi-Standard. Schrift kann auch in kleinen Größen wie gedruckt dargestellt werden. Klein, gut transportabel und mit hochaufgelöstem Display hat man sie in der Hand wie einen Notizblock. Auch lange Texte lassen sich stundenlang ohne Ermüdungserscheinungen auf diesen eBook-Readern lesen, ob sie nun Kindle, Kobo oder Tolido heißen oder gar Tablet-Computer sind, mit denen man sicher auch lange Texte lesen, jedoch noch deutlich eine mehr anstellen kann. In diesem Entwicklungsprozess des mobile Computings sind sicher auch das iPhone und das iPad zwei Meilensteine.
eBooks lesen
Also lesen wir heute eBooks auf dem e-Reader, Tablet oder Smartphone. Das ist gut so für den Leser, passen doch auf das Gerät der Inhalt von ganzen Regalwänden gedruckter Bücher. Wir haben immer die ganze Sammlung dabei und die zahlreichen Taschenbücher, Anleitungen für irgendwas, Ratgeber- und Fachbücher, mit vielen Infos darin, jedoch ohne gestalterischen Wert des Buches, diese Staubfänger sind wir los. Ebenso Kataloge, die alle Jahre neu erscheinen, und die gedruckt kein Mensch mehr braucht. Um nicht missverstanden zu werden: Ein gut gestaltetes, gut und aufwendig produziertes Buch mit nachhaltigem Inhalt ziehe ich immer dem eBook vor. Aber eben diese Taschenbücher, Ratgeber, Reisebücher, etc. – braucht man die wirklich gedruckt? Ich nicht.
eBooks produzieren, verlegen, vertreiben
Die eBooks befreien nicht nur den Leser von Staubfängern im Regal, sondern sie sind für die Autoren mindestens genauso hilfreich. Vor allem für die Autoren, die Texte und Inhalte veröffentlichen möchten, bei denen eben kein Verlag sagt: Yep, her damit, damit können wir Geld verdienen, das drucken wir. So ein eBook ist schnell produziert. Mit Bordmitteln, die jeder hat. Computer und etwas Software, letztere gratis oder zu geringem Preis zu haben (z.B. OpenOffice, Pages, Sigil, Jutoh, Calibre, etc.). Mehr braucht man nicht. Ach ja doch, – ich vergaß, KnowHow. Das ist der Punkt.
Autoren, die ihr eBook selbst veröffentlichen möchten, sind meist keine IT-Nerds und es ist mit dem KnowHow so eine Sache. Entsprechend werden werden dazu immer mehr Anleitungen geschrieben, manchmal auch von Laien für Laien – was man denn nun beachten müsse, bei Formatierung und Dateiformat und beim Einstellen in die großen Internet-Verkaufsplattformen.
Wollte früher zumindest jeder eine Handvoll Bücher gedruckt produziert haben, zum Rumzeigen, an Freunde verschenken, im Selbstverlag oder in einen Online-Shop zu verkaufen, so möchte heute jeder seine Texte und Inhalte mindestens als eBook veröffentlichen. Möchte man einen kleinen Selbstverlag aufziehen, um dann mit dem eigenen eBook in den großen Internet-Verkaufsplattformen präsent zu sein, braucht’s etwas mehr, als das reine eBook zu erstellen. Eine ISBN-Nummer muss her und man muss sich bei allen Plattformen (Online-Stores) anmelden, sich über Dateiformate und Konvertierungen schlau machen, um dann endlich das eBook jedesmal hochzuladen. Machbar, jedoch kein Kindergeburtstag. Vor allem für Menschen, die noch andere Beschäftigungen haben. Hat man einen Online-Store vergessen oder ignoriert, kommt’s natürlich blöd, dass gerade der Kollege oder Nachbar, der besonders interessiert an dem eBook ist, ein Lesegerät, einen e-Reader, hat, der nicht auf diesen Store zugreifen kann.
Dabei sind gerade dieses eBook-Konvertieren, Hochladen in die Online-Stores, Besorgen einer ISBN-Nummer, Eintrag ins VLB, etc. Vorgänge, die gut automatisiert werden können, weiß man einmal, wie es geht und hat die Manpower, so etwas IT-mäßig aufzusetzen.
Natürlich, die großen Dienstleister für die Selfpublisher-Szene haben diese Manpower und bieten ihre Dienste an. Sie stellen das hochgeladene eBook in nahezu alle Online-Stores. Da die Einrichtungsgebühr dafür meist ziemlich gering ist, bekommt der Dienstleister von jedem Verkauf einen Teil der Marge. So, wie es bei jedem Verlag üblich ist. Dafür muss sich der Autor nicht um die technischen und verlagsorganisatorischen Dinge kümmern, wie z.B. ISBN-Nummer, Registrierung bei den Online-Stores, konvertieren und hochladen, etc.
epubli bietet diese Leistungen für eBooks als auch für on-demand gedruckte Bücher an. BoD bot die eBook-Erstellung bisher jedoch nur im Zusammenhang mit einem on-demand gedruckten Buch an. Nun gibt es mit den →E-Shorts auch reine eBook-Dienstleistungen von BoD.
E-Short, der eBook-Quickie
Der Begriff E-Short kommt von BoD selbst. Damit ist ein eBook bis ca. 144000 Zeichen gemeint (80 →Normseiten). Diese Länge ergibt sich nicht durch technische Vorgaben, sondern wurde von BoD vermutlich aus wirtschaftlich-konzeptionellen Überlegungen festgelegt. Ein E-Short ist also nichts weiter als ein dünnes eBook.
E-Short, die Details
Es fällt keine Einrichtungspauschale für den Autor an. Das E-Short wird in einem Online-Editor direkt im Browser erstellt. Nachdem der Text geschrieben ist, wird er hochgeladen und der Preis für das eBook festgelegt. Alles andere erfolgt dann automatisch, – bis das eBook in fast allen wichtigen Online-Stores zum Verkauf steht. Von Amazon bis Thalia. Der Autor muss sich nur um das Schreiben und das Festlegen des Verkaufspreises kümmern. Alles andere erledigt BoD automatisch. Für diesen Service bekommt BoD 50 Prozent des Nettoverkaufspreises. Möchte man nur publizieren und nicht verkaufen, kann man auch einen Verkaufspreis von 0,00 Euro festlegen. BoD verdient daran dann gar nichts, stellt das E-Short aber als Gratis-Serviceleistung trotzdem in die Online-Stores.
50 Prozent des Netto-Verkaufspreises mögen viel erscheinen, bleiben dann doch nur 42 Cent vom eBook-Quickie – sprich E-Short –, für den der Kunde 99 Cent zahlt. Nun, dafür steht das eBook dann jedoch in allen Online-Stores, und der Aufwand für den Autor reduziert sich erheblich. Klar, dass das nicht umsonst ist. Allerdings ist entsteht auch kein Verlust oder Risiko, sollte das eBook nun gar niemand kaufen.
Getestet
Das alles machte mich etwas neugierig und ich habe vorgestern getestet, wie man ein E-Short erstellt. Ich habe dafür einen Text mit dem Tipps und Infos zum Schlösser-Hopping, einer speziellen Art des Reisens, verwendet. Aus dem soll jetzt via BoD ein kurzes eBook werden, ein E-Short als kleiner Reiseratgeber. Aus diesem Text hatte ich vor einiger Zeit mit der Software Sigil schon ein eBook erstellt. Jetzt möchte ich schauen, wie das im Online-Editor erzeugte eBook ausschaut und natürlich gerne den Effekt nutzen, dass es nachher in allen wichtigen Online-Stores steht. Da es keine Einrichtungspauschale gibt und die Zusammenarbeit mit BoD schnell gekündigt werden kann, gibt es kein Risiko. Im Moment kann ich also nur profitieren vom Service der E-Shorts. Und Ihr wollt doch bestimmt alle Schlösser-Hoppen?
Nachdem ich mir das Video zum Konzept der E-Shorts angeschaut hatte – mit sehr schöner Illustration im Retro-Style, ganz ohne glückliche Stockfoto-Gesichter, dafür jedoch mit eher mäßigem Werbetext – habe ich mich bei BoD registriert. Nach Eingabe von Autornamen, Titel, Kurzbeschreibung und Genre kann ich wählen, ob das eBook einen Kopierschutz haben soll. Dann komme ich zum Online-Editor, von BoD easyEditor genannt. Er bietet alle wichtigen Formatierungsmöglichkeiten für ein einfaches eBook. Kapitel anlegen, Text reinkopieren, formatieren, fertig. Geht es um einfache Formatierungen, wie sie in Text-eBooks meist Standard sind, dann funktioniert diese Art der eBook-Erstellung ganz gut. Der Editor bietet zudem die Möglichkeit, ein schon vorhandenes eBook als epub-Datei zu importieren. Ich habe es versucht, es funktionierte auch, nur leider wurde mein Inhaltsverzeichnis nicht korrekt importiert. Vielleicht liegt es an meinem epub, vieleicht am Editor. Ich habe den Text dann schließlich doch im Online-Editor formatiert. Schnell gemacht. Tadellos. Und vor allem schneller gemacht, als jetzt auf Fehlersuche zu gehen, warum der Import nicht korrekt funktionierte.
Im Editor gibt es eine Vorschau-Funktion, mit der man grob testen kann, wie das Ergebnis aussieht. Denn bei eBooks mit einem →reflowable Layout wird das angezeigte Ergebnis immer durch den e-Reader bestimmt.
Eine Besonderheit gibt es weiterhin. Es wird automatisch ein Kapitel ‚Impressum‘ angelegt, das den Namen des Autors mit einem Copyright-Vermerk enthält und BoD als Verlag. Dazu auch das Logo von BoD. Dieses Kapitel kann nicht gelöscht werden.
Nach Absenden bzw. Freischalten des fertigen eBooks zum Veröffentlichen muss man einem online generierten Verlagsvertrag zustimmen. Einige Rechte muss man BoD schon einräumen, jedoch ist die Vereinbarung ok., so dass man ohne Bauchgrimmen zustimmen kann. Der Verlagsvertrag hat keine feste Laufzeit und kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen beendet werden.
Und jetzt? …warte ich darauf, dass der Ratgeber zum Schlösser-Hopping in den Stores erhältlich ist. Ich schreibe auf jeden Fall etwas dazu, wenn es online ist.
Fazit
Ein E-Short zu veröffentlichen ist mit dem Online-Editor, dem sogenannten easyEditor, ein Kinderspiel und leicht wie Brötchenholen. Freilich, 80 Normseiten sind kein Roman und keine längere Erzählung. Aber Kurzgeschichten, Essays, kurze Ratgeber, längere Blog-Artikel und allerhand anderer Inhalt lässt sich gut darin unterbringen. Und, wie wäre es mit einer Fortsetzung von mehreren Teilen eines Romanes? Auch das lässt sich mit E-Shorts gut bewerkstelligen.
Da keine Einrichtungspauschale gezahlt werden muss, entstehen keine Kosten. Schön, man kann nur verdienen, in diesem System (wenn den eBook-Quickie denn jemand kauft). Ok, vielleicht könnte man mehr verdienen, wenn man das Technische und Verlagsorganisatorische selbst macht. Naja, wer viel Zeit hat… Auch BoD kann nur verdienen, wenn die eBooks verkauft werden. Bleibt zu hoffen, dass nicht bald der Girokonten-Effekt zuschlägt – anfangs waren diese Konten kostenlos, seit sie sich etabliert haben, kosten sie, und das nicht zu knapp.
Fakt ist natürlich, dass sich mit dem easyEditor keine komplexen Formatierungen realisieren lassen, wie sie bei reflowable eBooks bzw. epubs durchaus möglich wären. Ebenso lassen sich keine enhanced eBooks mit Audio- und Video-Bestandteilen damit erstellen. Für viele Inhalte ist das jedoch gar nicht erforderlich.
Sicher ist der easyEditor für Autoren mit wenig IT-Affinität eine Hilfe. Kennt man sich ganz gut aus und kann mit Sigil oder Jutoh schnell eBooks herstellen, bietet der easyEditor sicher nicht genug – auch weil man bei der online-eBook-Erstellung keine offline-Quelldaten vom erzeugten eBook bekommt und daher fest mit dem BoD-System verbandelt ist. Für die schnelle Nummer ist das meist alles nicht so wichtig. Schreiben, veröffentlichen, ab in den im Online-Store.
Würde BoD das System noch etwas aufbohren, z.B. wenn nach Vorlage erstellte Word-Dateien importiert werden könnten, dann sind die nicht so IT-affinen Autoren bestimmt richtig glücklich.
Ideen
Einige Ideen, was man in Form von E-Shorts veröffentlichen kann:
Kurzgeschichten, Essays, Berichte, Anleitungen, kurze Ratgeber, Unterrichtsmaterial, kurze Studien-Skripte, Koch- und Rezeptbücher, Seminararbeiten und Berufliches (so hat man schnell ein Veröffentlichungsverzeichnis für den CV).
Nachmachen. Auch machen. Bitte sehr.
Probiert’s einfach mal aus mit dem eBook-Quickie aka e-Short. Quickies sind doch immer gut. Eines ist natürlich klar: Testet man so ein System, fängt man nicht sofort mit seinen besten Inhalten an, die dann womöglich suboptimal formatiert und mit suboptimalem Preis in allen Online-Stores zum Verkauf stehen. Also alles erst ein oder besser zweimal testen, bevor Ihr dann die richtig guten Texte und Inhalte publiziert.
Sag ich doch
Publishing war noch nie so einfach wie heute.