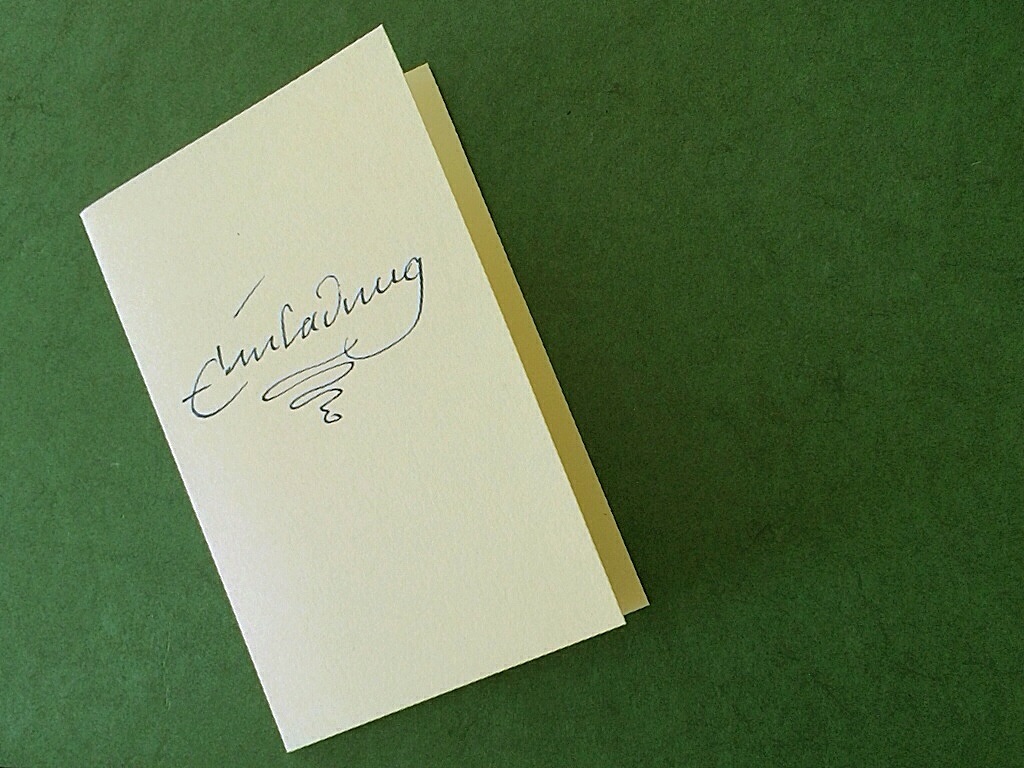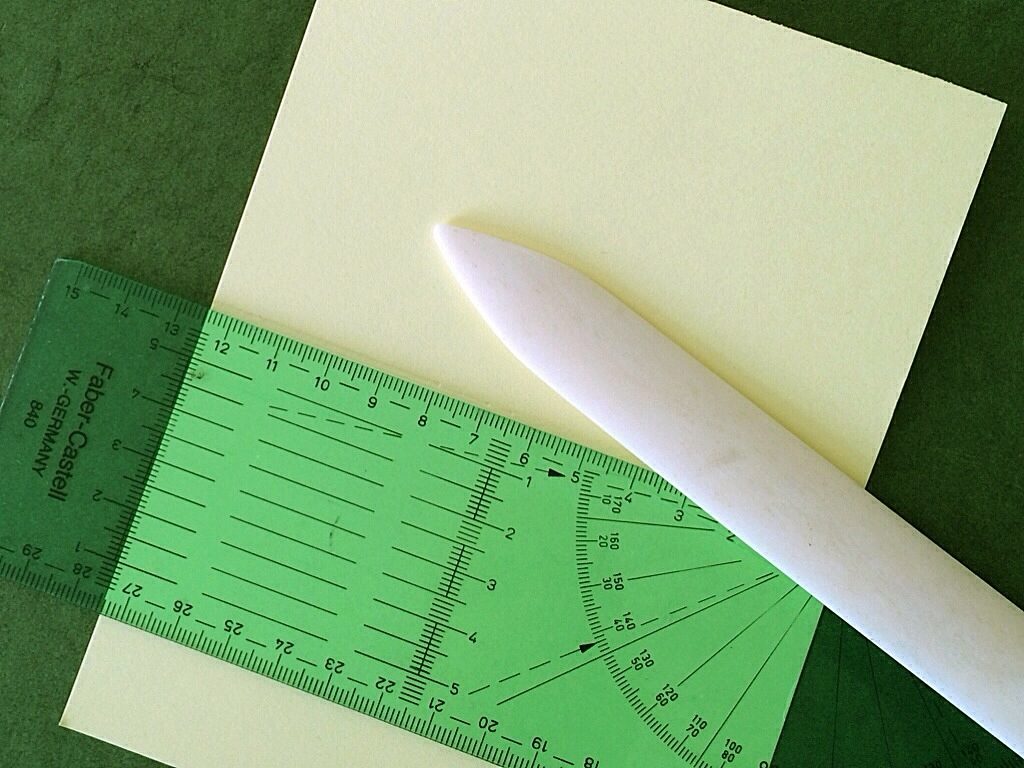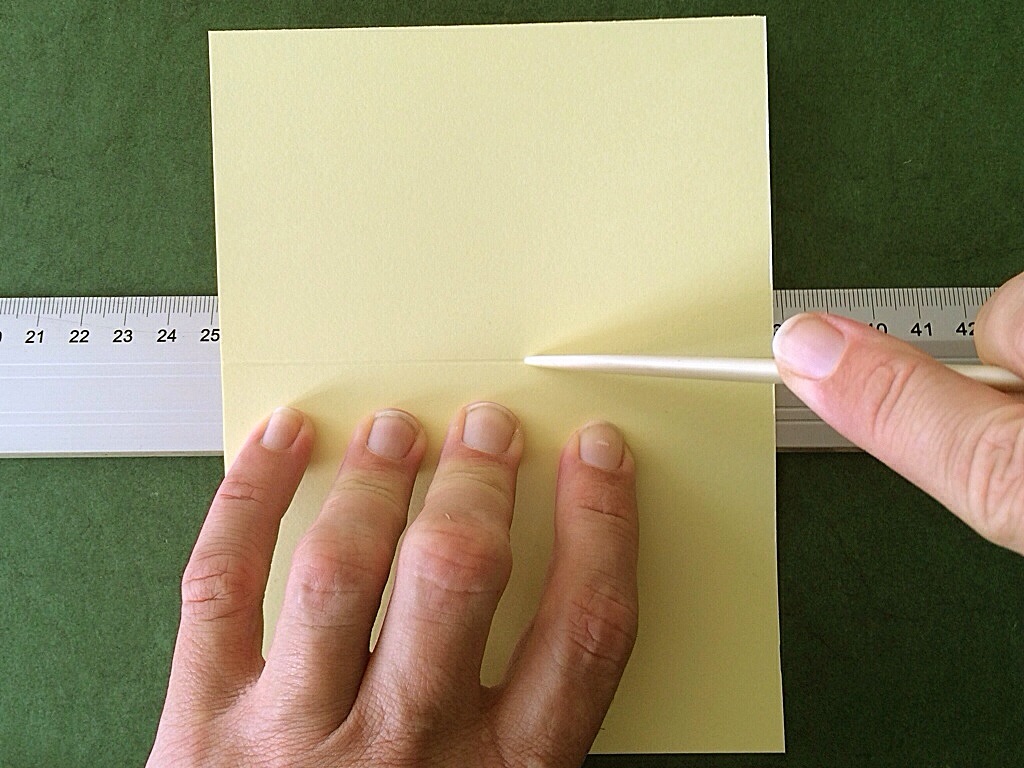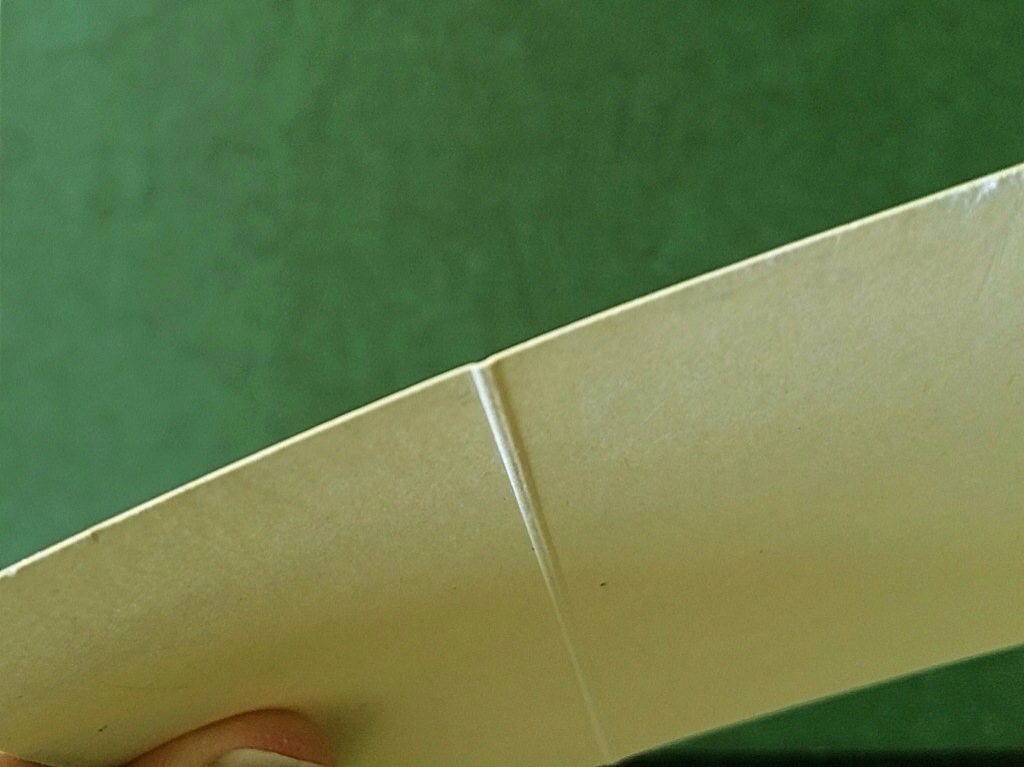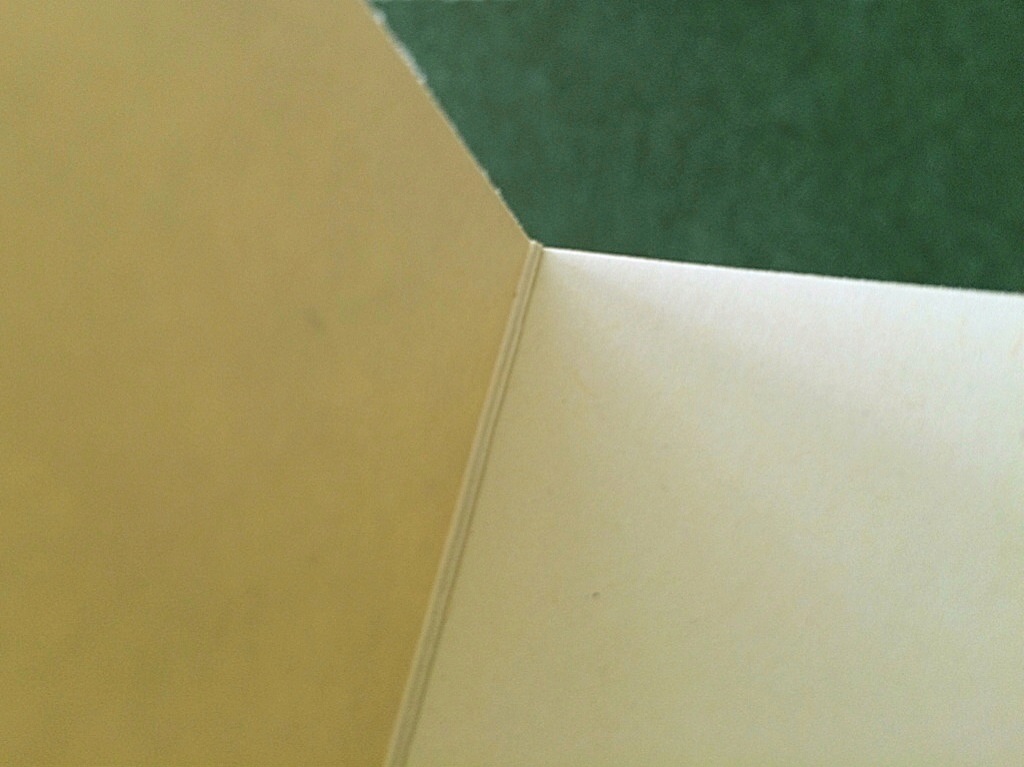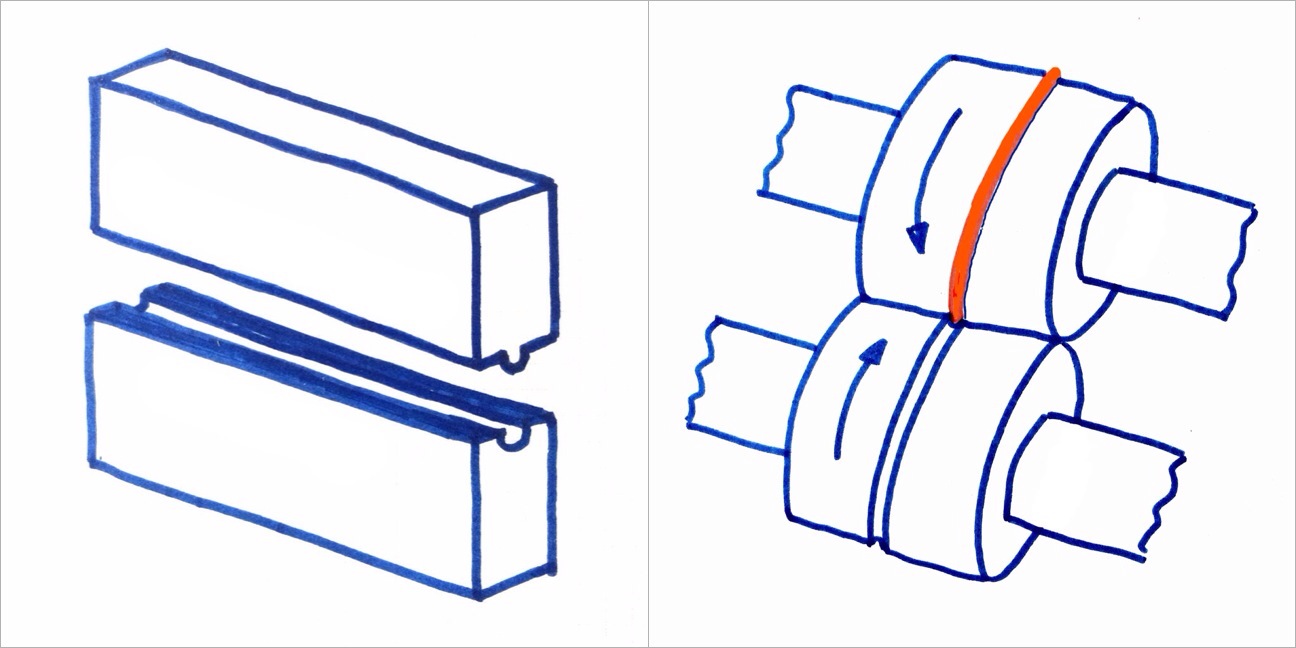Unabhängig – überparteilich – konfessionell nicht gebunden
So stand es als Untertitel auf den Lokalzeitungen in meiner Kindheit. Was unabhängig an sich bedeutet, wusste ich als Schulkind bereits, was eine Partei ist ebenso und auch, das konfessionell die Bedeutung von evangelisch oder katholisch hat. Nur, was hatte das mit einer Tageszeitung zu tun, da standen doch Nachrichten drin, Todesanzeigen, die meiner Großmutter las und eigentlich ziemlich wenig über Parteien. Was bedeutete also unabhängig, überparteilich und konfessionell nicht gebunden?
Einer der Erwachsenen hat es mir damals erklärt. Die Journalisten, die in der Zeitung schreiben, bekämen kein Geld dafür, dass sie ganz bestimmte Sachen schreiben oder sogar für Geld bewusst falsche Informationen schreiben würden. Sie wären unabhängig in dem, was sie schreiben. Mit überparteilich und konfessionell nicht gebunden habe es auf sich, dass Zeitungen früher oft das Sprachrohr von Parteien gewesen sein und deren Meinung als die einzig richtige verkündet hätten; außerdem gebe es Zeitungen, die der Meinung der Kirche besonders nach ständen und bestimmte Informationen so veröffentlichten, dass sie zur Meinung der evangelischen oder katholischen Kirche passten, z.B., auch indem einfach Informationen weggelassen würden. Eine Zeitung mit dem eingangs genannten Anspruch wäre jedoch von allem unabhängig. Mein kindlicher Wissensdurst war befriedigt. Vor allem die Aussage, dass man in einer Zeitung gar nicht lügen, also gezielt Falschinformationen verbreiten muss, sondern dass es reicht, durch einfaches Weglassen oder Übertreiben von Einzelheiten eine bestimmte Meinung bei den Lesern zu erzeugen, dass beeindruckte mich nachhaltig.
Die Geschichte der nächsten 40 Jahre kennen Sie: Boom der Tageszeitungen, das nicht ernst genommene Internet, Blogs, SocialMedia, MobileComputing, etc. Das Ergebnis ist meine Maxime: »Nie war Publishing so einfach wie heute«.
Blogs und Blogger hielt man lange für eine Spezies computerverliebter Menschen, die »irgendetwas ins Internet« schreiben und hat sie als Publisher von Inhalten, die zum Teil recht hohe Reichweiten haben, lange ignoriert. Erst in Zeiten, als der Abstieg der Printmedien unübersehbar ist und als Internetseiten nicht mehr mit gemerkter URL aufgerufen werden, sondern gut und gerne einfach per Suchphrasen via Google, das praktischerweise gleich mit dem URL-Eingabezeile verknüpft ist, erst dann entstand der Hype um Facebook-Likes sowie um Blogs und Blogger. Diese Schnellboote des Publishing, als one-man-show keinem Verleger oder Redakteur verantwortlich, dazu bei Google gut präsent, könnte man sie nicht bewegen, in ihren Texten etwas gezielte PR und Storytelling rund um Marken und Produkte zu machen. Man kann, und viele dieser one-man-shows sind wohl ganz glücklich, dass ab und zu mal ein zu testendes Produkt oder ein paar andere Benefits abfallen.
Das läuft dann so ab, dass ein Gartengerätehersteller plötzlich Blogger mit Gartenblogs im Fokus hat und diejenigen, die einigermaßen gut schreiben und etwas fotografieren können, erhalten den neuen Edelstahlspaten zum Test. Dazu vielleicht noch ein zweites Gartengerät und ein paar Tüten Blumensamen im Welcome-Paket. Den Spaten testet der Blogger, schreibt darüber einen Testbericht inklusive etwas Storytelling und einigen Fotos. Freilich, den Spaten darf er behalten, das Welcome-Paket auch, oder wenn es sich um Tests handelt, wo Produkte im Mittelpunkt stehen, die nicht einfach so verschenkt werden können, gibts vielleicht einen Fuffi oder einen Gutschein. Schon deswegen, weil es ja etwas geschenkt gibt, wird der Blogger zumindest das Produkt nicht komplett negativ darstellen. In den allermeisten Fällen geht diese Rechnung auf. Alle sind happy und es zieht sich durch die Blogs, was für’n tolles Gartengerät dieser Edelstahlspaten doch ist, gleich hinter der Japansäge.
Was ich hier anhand des Gartengerätes erklärt habe, ist im Bereich der Fashionblogs relativ verbreitet und auch das Multicity-Carsharing, über das ich gestern schrieb und das sich inzwischen durch viele Blogs zieht, war so eine Aktion. Freilich, der Blogger bekommt keine Vorgaben, was und wie lang er schreiben soll. Trotzdem ist es natürlich ein schmaler Grat zwischen dem Gefühl, verpflichtet zu sein und dem Wunsch, die Unabhängigkeit zu wahren.
Schnell kann es ganz unbewusst in die Richtung kippen, dass positive Wahrheiten in Verbindung mit dem getesteten Produkt überbetont und negative einfach weggelassen werden. Es würde einen als Hersteller dieses Spatens doch selbst ärgern, wenn der Blogger das Produkt bekommt und sich dann übermäßig negativ dazu äußert – die Sache mit dem geschenkten Gaul und seiner Zahngesundheit. Andererseits mögen es viele Leser ganz und gar nicht, wenn Produkte vorgestellt werden und dieses auf einer Kooperation des Bloggers mit der Marke bzw. dem Produktherstellers beruht. Manchem riecht das zu sehr nach fehlender Unabhängigkeit, wenn klar ist, dass es eine Gegenleistung für den Beitrag gab. Schnell ist der Generalverdacht da, Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit leiden. Ein schmaler Grat, der Fingerspitzengefühl erfordert.
Möchten meine Leser noch meine ernsthaften Ausführungen zu den provinziellen Kleinstädten mit ihrer Mittelmäßigkeit lesen, wenn ich im nächsten Beitrag etwas zu Multicity-Carsharing schreibe, das Ihnen bestimmt nicht das erste Mal in einem Blog begegnet ist und sie mitbekommen haben, dass ich für diesen Text die Registrierung und dreieinhalb Stunden Fahrzeit bekommen habe? Das ist es nicht wert, die Leser meiner Themen zu verlieren. Schwierig, Spagat, bisher schaffe ich ihn.
Auf der anderen Seite nehme ich natürlich gerne Angebote mit, die ich vielleicht selbst so nicht in Anspruch nehmen würde, die jedoch mein Wissen und meinen Horizont erweitern, über die ich vielleicht ohnehin, wenn auch mit anderem Fokus, bald schreiben würde und bei denen ich das Gefühl habe, es lohnt sich generell, sich einmal damit zu befassen.
Und was hat das alles mit dem Blogger Relations Kodex zu tun?
Pony und Blond, eine Agentur in Hamburg, die Kooperationen zwischen Bloggern und Marken bzw. Unternehmen zu ihrem Thema gemacht hat, haben den Blogger Relations Kodex geschaffen. Es geht um die Unabhängigkeit der Blogger, aber auch um generelles Interesse an Kooperationen. Lesen Sie dort. Eigentlich selbstverständliche Dinge, nur in wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht.
Dieses auf den Punkt bringen, Visualisieren und Manifestieren in Form eines Badges, den man auf den Seiten des eigenen Blogs platzieren kann, das finde ich eine gute Idee. Erstens hat es für die Leser bzw. Blogbesucher den Vorteil, schnell zu erkennen, dass in diesem Blog auch ab und zu Beiträge erscheinen, denen eine Kooperation mit Marken und Unternehmen zugrunde liegt. Zweitens ist es natürlich ein Signal nach außen, dass grundsätzlich eine Bereitschaft besteht, auch über Dinge zu schreiben, über die man sonst möglicherweise nicht oder in ganz anderem Zusammenhang schreiben würde, die jedoch interessant und beachtenswert sind. Und drittens kann man mit diesem Kodex ganz gut die unbedarften Anfragen kontern, die allen ernstes meinen, man würde für eine geringe Gegenleistung ihre Pressetexte im Blog veröffentlichen.
Schauen wir mal…
wie sich das so entwickelt mit dem Blogger Relations Kodex und ob er eine größere Relevanz in der Bloggeria erreicht. Die Idee ist jedenfalls gut.